![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Zwischen den Grenzen:
Saarland und Lothringen – Europas vergessene Mitte
Herbst 1979, Longwy. Keine Funken sprühen aus den Hochöfen, nur Rauch steigt von brennenden Barrikaden. Arbeiter werfen Pflastersteine, Frauen tragen Transparente, Kinder rennen zwischen Polizisten und Streikposten. „Longwy brennt“ – so schreibt es die Presse. Doch Paris hört nicht zu. Die Öfen verlöschen, die Stimmen verhallen.
Frühjahr 2012, Florange. Präsident Hollande tritt vor die Kameras, schwört Rettung, legt die Hand aufs Herz. Wenige Monate später ist alles vorbei, die Türme stehen still, rostige Skelette gegen den Himmel. Die Menschen, die Generationen lang Europa geschmiedet haben, gehen in die Arbeitslosigkeit.
Sommer 2025, Saarlouis. Auf dem Band steht die letzte Karosserie. Arbeiter filmen das Ende ihrer eigenen Geschichte mit ihren Handys. 46 Jahre lang war das Werk einer der größten Arbeitgeber des Landes. Heute ist es ein Grab aus Stahl und Schweigen.
Drei Szenen, drei Jahrzehnte, zwei Regionen. Lothringen und das Saarland – ein gemeinsames Schicksal, das nicht von Siegen erzählt, sondern von Verlust. Doch gerade im Verlust liegt Wahrheit.
Industrie als Identität und Abgrund
Seit dem 19. Jahrhundert war der Raum zwischen Saar und Mosel kein Rand, sondern ein Herz. Lothringisches Erz, saarländische Kohle – zusammen gaben sie Europa das Rückgrat. In Florange, Hayange, Dillingen und Völklingen wurde nicht nur Stahl produziert, sondern auch Selbstbewusstsein.
Diese Arbeit war keine romantische, sondern eine harte, die Körper zerstörte und Familien an den Takt der Schichtbanduhr kettete. Aber sie schuf Würde. Die Männer, die nach zwölf Stunden mit schwarzen Gesichtern nach Hause kamen, trugen Stolz in den Augen. Die Frauen, die Familien ernährten, während die Männer unter Tage verschwanden, waren die stillen Heldinnen dieser Epoche.
Dann kam der Bruch. Lothringen verlor in den 1970er und 80er Jahren seine Hochöfen. Longwy war das Symbol, Florange das Epilog. Im Saarland hielt sich die Industrie länger, doch der Verlauf war derselbe. 2012 fiel der letzte Stollen in Ensdorf, 2025 das letzte Auto in Saarlouis. Beide Regionen verloren nicht nur Arbeitsplätze, sondern Identität.
Die verpasste Chance von 1955
Im Oktober 1955 stand das Saarland am Scheideweg. Das Saarstatut bot die Möglichkeit einer Teilautonomie, unter europäischer Kontrolle, eng verbunden mit Frankreich. Johannes Hoffmann und Gilbert Grandval sahen darin eine Vision: ein Modell, das die Region zu einem Labor Europas machen konnte. Nicht Objekt der Politik, sondern Subjekt.
67,7 Prozent der Saarländer sagten Nein. Eine Entscheidung, die Sicherheit versprach – Renten, D-Mark, die Rückkehr in die Bundesrepublik. Doch zugleich eine verpasste Gelegenheit. Wäre das Saarland diesen Weg gegangen, hätte es zusammen mit Lothringen und Luxemburg ein eigenes Zentrum bilden können – eine Region, die nicht an Paris oder Berlin hing, sondern an sich selbst.
Heute, siebzig Jahre später, wirkt diese Frage brennender denn je. Paris hat Lothringen im „Grand Est“ aufgelöst, Berlin denkt laut über eine Eingemeindung des Saarlandes nach Rheinland-Pfalz nach. In beiden Fällen dieselbe Logik: Verwaltung statt Selbstbestimmung, Auflösung statt Eigenständigkeit.
Grenzen, die nicht verschwinden
Die politische Rhetorik spricht von offenen Grenzen, die Realität zeigt anderes. Die Saarbahn fährt bis Saargemünd – und endet dort. Metz, kaum 80 Kilometer entfernt, bleibt ohne direkte Verbindung. Eine Stunde könnte es dauern, stattdessen wird es eine Odyssee mit Umsteigen.
Tausende pendeln dennoch täglich. Lothringer arbeiten in saarländischen Kliniken, Saarländer kaufen Häuser in Moselle. Auf Märkten treffen Rostwurst und Quiche lorraine aufeinander. Im Alltag wird gelebt, was die Politik nicht organisiert bekommt.
Die Grenze ist offiziell verschwunden, doch sie wirkt weiter – nicht mehr im Schlagbaum, sondern in den Köpfen, in den Fahrplänen, in den Förderprogrammen, die nebeneinander existieren, ohne ineinanderzugreifen.
Kultur des Dazwischen
Identität in dieser Region ist keine Frage von Pässen, sondern von Geschichten. Großväter, die in Forbach in den Minen arbeiteten, Söhne, die in Dillingen am Hochofen standen, Töchter, die in Nancy studierten und in Saarbrücken lebten.
Dieses Leben im Dazwischen ist keine Schwäche. Es ist eine Ressource. Wer hier lebt, weiß, dass man französisch fühlen und deutsch sprechen kann, dass man zwischen den Welten steht und doch Haltung bewahrt.
Es ist auch eine Kultur des Widerstands. Nicht spektakulär, nicht heroisch im Sinne der Denkmäler, sondern alltäglich. Familien, die blieben, obwohl die Fabriken schlossen. Frauen, die die Haushalte trugen, während die Männer ihre Arbeit verloren. Studenten, die zweisprachig groß werden, obwohl die Schulen sie oft monolingual erziehen wollen.
Philosophie des Erinnerns
Der Philosoph Paul Ricoeur sprach von der Dialektik zwischen Erinnerung und Vergessen. In Lothringen und im Saarland wirkt diese Dialektik wie ein Fluch. Erinnern – an Kriege, an Industrie, an Identität. Vergessen – an Orte, die verschwanden, an Namen, die getilgt wurden, an Dörfer, die aufgegeben wurden.
Paris will, dass Lothringen als Begriff verschwindet, aufgelöst im „Grand Est“. Berlin will das Saarland schwächen, indem es ihm Eigenständigkeit nimmt. Beide Seiten fürchten die Erinnerung daran, dass diese Region auch allein stehen könnte.
Doch Erinnerung lässt sich nicht löschen. Sie lebt in den Stichen von Jacques Callot, die das Leiden der Zivilisten im Dreißigjährigen Krieg zeigen. Sie lebt in den Ruinen von La Mothe, im Weltkulturerbe der Völklinger Hütte, in den Gesichtern derer, die noch wissen, wie Schichtdienst roch.
Das letzte Wort gehört uns
Saarland und Lothringen sind kein Rand. Sie sind eine Mitte, die Europa vergessen hat. Eine Mitte, die gelernt hat, mit Brüchen zu leben. Eine Mitte, die ihre Zukunft nicht aus Gnade der Hauptstädte erwarten darf, sondern selbst behaupten muss.
Wenn der Wind über die stillgelegten Hochöfen weht und leere Parkplätze in Saarlouis vom Ende einer Epoche erzählen, dann liegt darin keine Resignation. Darin liegt die Erinnerung daran, dass Haltung mehr bedeutet als Besitz. Dass Widerstand nicht nur militärisch ist, sondern sprachlich, kulturell, alltäglich.
La Dernière Cartouche – das heißt, nicht aufzugeben, wenn alles verloren scheint. Es heißt, das letzte Wort zu erheben, wenn andere schweigen. Für das Saarland, für Lothringen, für eine Region, die nicht Randgebiet ist, sondern Herz.
Sinn entsteht im Zwischen. Hier liegt die Stärke dieser Region: nicht deutsch, nicht französisch, sondern beides und mehr. Keine Randnotiz, sondern Mitte. Keine bloße Erinnerung, sondern eine offene Zukunft. Genau dort liegt die Stärke dieser Region: Nicht Anhang, sondern Mitte. Nicht Erinnerung allein, sondern auch Zukunft.
Robert Schuman – aus der Wunde eine Vision
Es ist kein Zufall, dass einer der Väter Europas aus Lothringen kam. Robert Schuman, in Luxemburg geboren, in Metz ausgebildet, geprägt von den Brüchen seiner Heimat, wusste: Frieden wächst nicht in den Hauptstädten, sondern an den Rändern. Dort, wo Menschen gezwungen sind, täglich mit der Grenze zu leben.
Am 9. Mai 1950 sprach er den Satz, der seither als Gründungswort Europas gilt:
„Der Frieden der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohungen entsprechen.“
Er wusste, wovon er sprach. Seine Heimat hatte erlebt, wie Kohle und Stahl zu Waffen wurden. Darum schlug er vor, genau diese Kräfte in gemeinsame Hände zu legen – nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Aus der Montanunion wurde die erste Architektur eines neuen Europa.
Schuman bleibt damit auch für uns im Saarland und in Lothringen eine Mahnung. Unsere Zukunft entscheidet sich nicht in Paris oder Berlin, sondern hier, in der Mitte, wo aus den Wunden von gestern die Möglichkeiten von morgen erwachsen.




 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 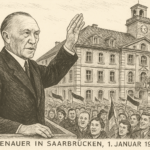
 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 





















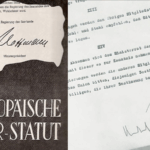 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.