![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
„Lothringen brennt“
Der verschwiegen Entvölkerungskatastrophe des Dreißigjährigen Krieges
Ein Essay über Leiden, Macht und das Schweigen der Geschichte
Prolog: Der Winter 1636
Januar 1636. Über den Feldern bei Saint-Avold liegt Rauhreif wie ein Leichentuch. Die Speicher sind leer, das Vieh fort, die Wege still. Männer knien im gefrorenen Boden, hebeln Wurzelbüschel aus der Erde, Frauen kochen Gras und Rinde, Kinder halten die letzte Kruste zwischen den Zähnen. Am Waldrand zieht eine Kolonne durch – Schweden, Spanier, Franzosen, Söldner, die längst nicht mehr wissen, wofür sie kämpfen, nur noch, dass sie hungern. Die Reihe löst sich auf in Trupps, die über Zäune steigen, Erntereste zusammentragen, Türen aufstoßen. Wer widerspricht, endet am dicken Ast der alten Eiche. Die Galgenbäume sind die neuen Wahrzeichen des Landes.
Die Zahlen, die später in Chroniken und Steuerlisten auftauchen, sprechen eine stumme Sprache: In drei Jahrzehnten schrumpft die Bevölkerung Lothringens um vierzig bis sechzig Prozent – bis zu 250.000 Tote, Namenlose, deren Leben in keinem Heldenepos verzeichnet steht. Sie sterben an Hunger, Fieber, Ruhr, Erschöpfung, an der Gewalt der durchziehenden Heere. Aus der politischen Karte Europas wird vor Ort ein täglicher Verteilungskampf um Brot, Salz, Feuerholz. Lothringen, zwischen Reich und Frankreich eingeklemmt, wird zum Korridor der Armeen und zum Becken ihrer Rückstände: verbrannte Dörfer, vergewaltigte Frauen, verwaiste Kinder, verödete Felder.
Das Leiden der Menschen: Die Stimme der Namenlosen
Der Hunger: Wenn der Körper sich selbst verzehrt
In den Pfarreibüchern von Saint-Avold, Toul oder Nancy finden sich Einträge wie: „Anna, Tochter des Michel, gestorben an Hunger, 12 Jahre alt“ oder „Familie Legrand, fünf Seelen, alle im Februar erloschen“. Die Menschen sterben nicht nur an Entkräftung, sondern an dem, was der Hunger mit ihnen macht: Sie werden schwach, anfällig für die Pest, die Ruhr, das „Fieber“, das in den Hütten umgehert wie ein unsichtbarer Henker. Die Seuche vollendet, was der Krieg beginnt.
Die Gewalt: Wenn die Heimat zum Schlachtfeld wird
Jacques Callots Radierungen zeigen es ungeschminkt: Soldaten, die Bauern an den Haaren durch die Dörfer zerren, Frauen, die sich an die Wand pressen, während Marodeure ihre Häuser plündern. In den „Grandes Misères de la guerre“ gibt es eine Platte, die besonders erschüttert: „La Pendaison“ – die Hängung. Ein Galgenbaum, an dem Zivilisten baumeln, während im Hintergrund die Soldaten weiterziehen, als wäre dies nur eine Routine des Krieges. Callot, selbst Lothringer, kennt diese Szenen. Er sieht, wie Nachbarn zu Feinden werden, wie Misstrauen die Gemeinschaften zerfrisst, wie die Schwächsten – Alte, Kinder, Kranke – als Erste fallen.
Die Vertriebenen: Wenn die Straße zum letzten Zuhause wird
Auf den Wegen zwischen Metz und Nancy ziehen Kolonnen von Vertriebenen, ihre Habseligkeiten auf Karren, die Kinder in Mänteln, die ihnen seit Jahren nicht mehr passen. Sie fliehen vor den durchziehenden Heeren, vor den Bränden, vor der Rekrutierung. Viele von ihnen werden nie ankommen. In den Archiven findet sich der Bericht eines Pfarrers aus Toul: „Sie kamen abends, baten um Obdach, am Morgen lagen drei von ihnen tot im Stall. Wir gruben sie hinter der Scheune, ohne Glocken, ohne Gebet.“
Die Frauen: Die unsichtbaren Trägerinnen der Last
Während die Männer in den Krieg gezogen, geflohen oder erschlagen sind, bleiben die Frauen zurück. Sie halten die Familien zusammen, vergraben die Toten, betteln um Brot, verstecken die letzten Vorräte vor den Marodeuren. In den Steuerlisten tauchen sie plötzlich als „Haushaltsvorstände“ auf – ein stummer Beweis dafür, dass die Männer fehlen. Und doch: Ihre Stimmen fehlen in den Chroniken. Ihre Geschichten wurden selten aufgeschrieben. Nur in den Randnotizen der Pfarrer, in den Gerüchten, die sich von Dorf zu Dorf tragen, bleibt ihr Leiden präsent: „Die Witwe Claudel hat ihr letztes Hemd für ein Brot gegeben.“
Die kalte Politik: Machtspiele über Leichen
Richelieu und Mazarin: Die Architekten der Entvölkerung
Kardinal Richelieu sieht in Lothringen ein Hindernis – ein Herzogtum, das sich der französischen Vorherrschaft widersetzen könnte. Sein Plan ist eiskalt: „Lothringen muss entmilitarisiert, entfestigt, entvölkert werden, damit es nie wieder eine Bedrohung darstellt.“ Er ordnet die Schleifung der Burgen an, die Zerstörung der befestigten Städte. La Mothe, Symbol des Widerstands, wird 1645 dem Erdboden gleichgemacht – nicht aus militärischer Notwendigkeit, sondern als Exempel.
Mazarin führt diese Politik fort. Während in Paris über Diplomatie und Allianzen verhandelt wird, stirbt in Lothringen die Bevölkerung. Die „Raison d’État“ rechtfertigt alles: „Ein entvölkertes Land ist leichter zu regieren als ein aufständisches.“ Die Heere, die durch Lothringen ziehen, sind nicht nur Söldner, sie sind Werkzeuge dieser Strategie. Sie requirieren, sie verbrennen, sie töten – und sie ziehen weiter, während die Überlebenden zurückbleiben, um die Trümmer zu begraben.
Die Heere: Eine Logistik des Todes
Der Dreißigjährige Krieg ist der erste „totale“ Krieg der Neuzeit. Die Armeen leben nicht von Nachschub, sie leben vom Land. „Nimm, was du brauchst.“ Die Soldaten plündern systematisch. Sie nehmen das Getreide, das Vieh, die letzten Vorräte. Sie hinterlassen verbrannte Scheunen, vergiftete Brunnen, vergewaltigte Frauen. „Das ist kein Krieg mehr, das ist ein Gemetzel“, schreibt ein schwedischer Offizier 1637 in sein Tagebuch.
Die Verträge: Papier über Massengräbern
1648 wird der Westfälische Friede unterzeichnet. Die Diplomaten feiern sich, die Karten Europas werden neu gezeichnet. Lothringen? Eine Fußnote. Frankreich erhält Teile des Herzogtums, die Festungen bleiben zerstört, die Bevölkerung dezimiert. „Der Frieden ist gemacht“, verkündet der französische Gesandte – während in den Dörfern die Überlebenden versuchen, auf den Ruinen ihrer Häuser weiterzuleben.
Das Fehlen der Erinnerung: Warum Lothringen vergessen wurde
Die Sieger schreiben die Geschichte
Nach 1648 wird in Frankreich der Mythos vom „großen König“ Ludwig XIV. gepflegt. Die Leiden der Provinz passen nicht in dieses Bild. In Deutschland wird der Krieg als „deutsche Katastrophe“ erzählt – doch Lothringen, zwischen Reich und Frankreich zerrieben, findet in keiner Erzählung wirklich Platz. Die Denkmäler, die später entstehen, gelten den Schlachten des 19. und 20. Jahrhunderts. Für die Opfer von 1636 gibt es keine Steine.
Die Sprache des Schweigens
In den Familien wird das Trauma weitergegeben, aber selten benannt. Die Enkel fragen: „Warum sind wir so wenige?“ Die Antwort ist ein Achselzucken, ein „Das waren harte Zeiten.“ Die Chroniken der Städte brechen ab, die Pfarreibücher haben Lücken. „Manche Seiten sind leer, als hätte jemand sie herausgerissen“, sagt ein Archivar in Nancy.
Die Natur als einziges Mahnmal
Heute wächst Wald über den Ruinen von La Mothe. Die Hügel, auf denen einst die Festung stand, sind von Büschen überwuchert. Wer dort steht, sieht nur noch die Konturen der alten Gräben, spürt unter den Füßen die Steine der zerstörten Häuser. „Hier war eine Stadt“, sagt ein Schild – mehr nicht.
Ein Appell: Warum wir uns erinnern müssen
Die Geschichte Lothringens im Dreißigjährigen Krieg ist mehr als eine regionale Tragödie. Sie ist eine Warnung: Was passiert, wenn Politik die Menschen vergisst. Was bleibt, wenn die Erinnerung schwindet. Und wie leicht Leiden in Statistiken versinkt.
Denkmäler, die berühren
- Ein „Pfad der Namenlosen“ entlang der alten Straßen von La Mothe, mit Schildern, die die rekonstruierten Namen der Opfer zeigen.
- Ein „Garten der verschwundenen Dörfer“ in Nancy, für jedes zerstörte Dorf ein Baum, eine Tafel mit den wenigen überlieferten Namen.
- Eine „Klanginstallation“ in den Wäldern von La Mothe, die die Namen der Toten flüstert, wenn der Wind durch die Bäume streicht.
Bildung: Die Lücken füllen
- Schulprojekte, die die „Lothringische Katastrophe“ lehren – mit Zeitzeugenberichten, Rollenspielen, Exkursionen.
- Ein „Jahrbuch der Namenlosen“, das die Forschungsergebnisse zu den Opfern veröffentlicht.
- Eine digitale Gedenkstätte, die Callots Radierungen mit interaktiven Karten und Dokumenten verknüpft.
Politik der Erinnerung
- Eine offizielle Entschuldigung der französischen und deutschen Regierungen.
- Ein „Tag der verschwundenen Dörfer“ in Lothringen.
- Ein Forschungsfonds für Historiker und Archäologen, die nach Spuren der Zerstörung suchen.
Epilog: Was wir den Toten sagen
Wenn wir heute an den Ruinen von La Mothe stehen, sollten wir zuerst schweigen. Schweigen, weil Worte angesichts der Leere anmaßend klingen. Dann sollten wir den Toten sagen: Euer Sterben war nicht namenlos. Man wollte, dass ihr vergessen werdet, dass eure Stadt unter Gras und Wald verschwindet, dass selbst der Klang eurer Namen im Gebet erlischt. Aber ihr seid noch da. In den Stichen Callots, in den Chroniken, in den Zahlen, die Historiker entziffern, in den Wäldern, die über euren Mauern wachsen. Wir verneigen uns vor eurer Standhaftigkeit, vor eurem Leiden, vor der Tatsache, dass ihr trotz aller Gewalt Teil einer Geschichte bleibt, die nicht ausgelöscht werden kann.
Und zu den Lebenden sollten wir sagen: Hört auf, euch mit dem Schweigen abzufinden. Geschichte wird nicht von selbst gerecht. Sie verlangt, dass man ihr ins Gesicht schaut, auch wenn es schmerzt. Lothringen hat seine Denkmäler nicht nur für die Helden der Résistance oder die Soldaten von Verdun verdient, sondern auch für die Bauern, Kinder und Frauen, die im 17. Jahrhundert geopfert wurden, weil sie am falschen Ort zwischen den Fronten lebten.
Erinnerung ist kein Ressentiment. Erinnerung ist Gerechtigkeit. Wer sie verweigert, macht sich mitschuldig am zweiten Tod – dem Tod im Vergessen.
Quellen und Inspirationen:
- Chroniken und Selbstzeugnisse aus Lothringen, 1630–1650
- Jacques Callots „Grandes Misères de la guerre“ (1633)
- Berichte zur Zerstörung von La Mothe (1645)
- Politische Korrespondenz Richelieus und Mazarins
(Dieser Essay ist allen Lothringern gewidmet – mit der Hoffnung, dass die Stimmen der Namenlosen endlich gehört werden.)
Quellennachweis
Quellenverzeichnis
Primärquellen & Chroniken
- „Lothringen“, Der Dreißigjährige Krieg in Selbstzeugnissen, Chroniken und Berichten – Berichte und Selbstzeugnisse aus Lothringen, 1630–1650, inkl. Augenzeugen zu Belagerungen, Hungersnöten und Truppenbewegungen. Online
- Wikipedia, Festung La Mothe – Schilderung der Belagerung und Zerstörung 1645, mit Quellen- und Literaturhinweisen. Online
- France Culture, „Ci-gît La Mothe“ – Audio-Dokumentation zur Vernichtung der Festung La Mothe, mit zeitgenössischen Zitaten. Online
Kunst & Kulturgeschichte
- HoffnungFNZ, „Die Vision eines moralischen Krieges: Les Misères et les Malheurs de la Guerre von Jacques Callot“ – Analyse der Radierungen als erste „anti-kriegerische“ Kunst Europas. Online
- Wikipedia, Les Grandes Misères de la guerre – Überblick über Werk, Technik und Rezeption Callots, mit Verweisen auf Louvre-Exemplare. Online
- Louvre Collections, „La Pendaison“ – Digitale Ansicht des Originals mit technischen Erläuterungen. Online
Politik & Militärgeschichte
- Wikipedia, Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu – Biographie mit Fokus auf die Lothringen-Politik und die „Raison d’État“. Online
- Histrhen, „Mazarin in Brühl“ – Mazarins Rolle bei der Fortführung von Richelieus Politik. Online
- Die Tagespost, „Als Kardinal Richelieu die französische Politik beherrschte“ – Analyse der Machtmechanismen Richelieus und ihrer Folgen für Lothringen. Online
Sekundärliteratur & Forschung
- Planet Wissen, „Der Westfälische Friede“ – Zusammenfassung der Verträge von 1648 und ihre Folgen für Lothringen. Online
- Bundeszentrale für politische Bildung, „Dreißigjähriger Krieg“ – Überblick über den Krieg, Fokus auf Demographie und Zivilbevölkerung (PDF). Online
- Frühneuzeit-Info, „Dreißigjähriger Krieg“ – Blog mit Rezensionen und Literaturhinweisen zu neueren Studien. Online
Alle Links zuletzt geprüft am 23. September 2025. Für wissenschaftliche Arbeiten bitte Originalquellen und Archivbestände konsultieren.




 Le JOUR POLITIQUE
Le JOUR POLITIQUE © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche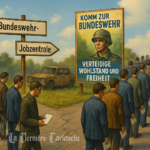 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche





















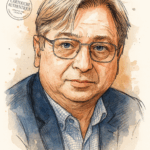 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.