![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Vom Könner zur Geste
Über Markus Lüpertz, die Augsburger Skulpturen und den Verlust der Mitte
Edelstahlskulptur Ostern von Brigitte Denninghoff und Martin Matschinsky vor dem Augsburger Theater (Kennedyplatz)
Vom Könner zur Geste
Über Markus Lüpertz, die Augsburger Skulpturen und den Verlust der Mitte

Markus Lüpertz
Markus Lüpertz steht wie ein Prüfstein in der Landschaft der Gegenwartskunst¹. Seine Figuren wirken monumental und zugleich unbeholfen, pathetisch und leer. Sie zitieren die Antike, beschwören die Aura des Heroischen, reden von Schönheit und Größe – und hinterlassen doch den Eindruck, als habe der Künstler den menschlichen Körper nie wirklich verstanden². Darin liegt keine persönliche Anklage, sondern ein Symptom. An Lüpertz lässt sich ablesen, was aus der Kunst geworden ist, seit sie das Können durch das Konzept ersetzt hat³.
Michelangelo verstand Anatomie nicht als technische Disziplin, sondern als Sprache des Göttlichen⁴. Jeder Muskel in seinen Figuren ist Gedanke und Gebet zugleich. Rodin befreite diese Sprache aus der dogmatischen Form⁵: seine Körper zittern, suchen, vergehen, bleiben offen. Käthe Kollwitz verwandelte die Anatomie in Empathie⁶. Ihre Körper tragen die Welt, nicht den Mythos. In ihrer Plastik Mutter mit totem Sohn spürt man jede Spannung, jedes Gewicht, jede Falte, weil sie aus Erfahrung modelliert ist, nicht aus Attitüde⁷.
Von dieser Linie führt ein langer Weg in die Moderne, ein Weg der bewussten Reduktion. Wilhelm Lehmbruck verlängert den Körper, um seine Melancholie zu zeigen⁸. Ernst Barlach bricht ihn, um seine Seele zu retten⁹. Constantin Brâncuși glättet ihn zur Essenz, Henry Moore öffnet ihn ins Leere¹⁰. In allen diesen Gesten steckt Wissen. Man darf nur weglassen, was man zuvor begriffen hat. Ihre Abstraktion bleibt von Beherrschung getragen.
Nach dem Krieg verschiebt sich der Schwerpunkt. Mit Joseph Beuys wird Skulptur Handlung, soziale Plastik¹¹. Mit ihm wird der Bruch mit dem Handwerk selbst zur Befreiung. Das Material verliert seine innere Notwendigkeit, die Idee tritt an seine Stelle. Die Avantgarde feiert diesen Umsturz als Erlösung. In den 1980ern wird Rohheit selbst zur Sprache¹². Georg Baselitz zersägt den Stamm, A. R. Penck verwandelt den Menschen in Piktogramme¹³. Die Oberfläche wird wichtiger als der Körper, die Geste ersetzt die Form. Was als Emanzipation begann, endet als Manierismus des Ungekonnten.
Lüpertz steht am Ende dieser Bewegung. Seine Venus – ein mythologisches Zitat ohne Mythos – wirkt wie ein Echo vergangener Größe¹⁴. Die Proportionen sind unsicher, die Gelenke zufällig gesetzt, der Körper gleitet aus der Anatomie ins Symbol. Wo Michelangelo Bewegung schuf, findet man hier nur eine bloße Behauptung. Das könnte noch immer Kunst sein, wenn die Geste eine Notwendigkeit hätte. Doch häufig bleibt sie Pose, ein Bild vom Bild. Lüpertz spricht von Pathos, aber er formt keine Spannung. Kein Gewicht, nur Geste. Er will den Körper monumental machen und erreicht lediglich Masse.

Skulptur “Venus” von Markus Lüperts
In Augsburg wurde diese Leerstelle sichtbar. Als eine Lüpertz-Venus dort präsentiert wurde, erhob sich Widerspruch¹⁵. Die Diskussion drehte sich nicht nur um Geschmack, sondern um das Verhältnis zwischen Werk, Stadt und Öffentlichkeit. Bürger fragten, was diese Figur mit ihnen zu tun habe. Politiker wiesen auf den Preis hin, Kritiker auf die Anmaßung. Der Künstler selbst sprach von Missverständnis. Doch der Streit zeigte: Das Missverständnis war längst Methode geworden. Die Skulptur sollte provozieren, weil Provokation das letzte Zeichen von Bedeutung geworden ist¹⁶. Nach den Protesten wurde sie abgebaut, später auf dem Gelände eines Verlages erneut aufgestellt – ein Werk, das sich nur noch selbst adressiert¹⁷.
Ein ähnlicher Konflikt spielte sich wenige Jahre zuvor ab, mit anderer Form, gleichem Verlauf. Auf dem Augsburger Kennedyplatz steht die sechs Meter hohe Edelstahlskulptur Ostern von Brigitte Denninghoff und Martin Matschinsky¹⁸. Sie wurde 1992 auf dem Rathausplatz enthüllt¹⁹, glänzend, kühl, spiralisch verdreht, eine Bewegung aus Stahl. Das Künstlerpaar arbeitete seit Jahrzehnten an solchen Formen, Variationen desselben Prinzips in vielen Städten²⁰. Augsburg erhielt also kein Unikat, sondern eine Variante. Der Titel Ostern weckte religiöse Erwartungen, die Form enttäuschte sie. Leserbriefe sprachen von einer Beleidigung, vom Verlust des Maßes, von einer Stadt ohne Augen²¹. Nach Protesten wurde die Skulptur abgebaut und vor dem Stadttheater wieder errichtet²², dezentraler, ruhiger, weniger sichtbar. Heute gilt sie als Teil des Stadtbilds, kaum noch beachtet, aber nicht mehr gehasst.
Beide Fälle erzählen dieselbe Geschichte. Eine Stadt, die nach Identität sucht, trifft auf eine Kunst, die keine vermitteln will. Die Künstler berufen sich auf Freiheit, die Bürger auf Zugehörigkeit. Dazwischen steht die Verwaltung, die Modernität verwalten muss. Die Kunst will nicht gefallen, das Publikum will sich wiederfinden. Niemand hört dem anderen zu. So entsteht aus Kommunikation Skandal, aus Skandal Routine.
Wer den Bürger deshalb zum Banausen erklärt, verwechselt Unverständnis mit Sehnsucht²³. Die Augsburger wollten nicht weniger Kunst, sie wollten spüren, dass Kunst sie betrifft. Ein Werk, das nur sich selbst erklärt, bleibt leblos im Raum stehen, egal wie teuer oder bedeutungsvoll es sich nennt. Auch in den großen Jahrhunderten war Kunst nie nur Autonomie. Michelangelos David war politisches Symbol²⁴, Rodins Bürger von Calais waren kollektive Erinnerung²⁵, Kollwitz’ Mutter mit totem Sohn war Trauerarbeit²⁶. Der Unterschied liegt nicht zwischen Moderne und Tradition, sondern zwischen Werk und Welt.
Die Moderne hat das Handwerk nicht verloren, sie hat es entwertet²⁷. Sie hat aus der Sprache des Körpers eine Syntax der Attitüde gemacht. Das Publikum spürt die Leere, reagiert mit Ablehnung, und die Künstler deuten diese Ablehnung als Beweis für ihre Tiefe²⁸. In Wahrheit sind beide Seiten Opfer derselben Distanz.
Vielleicht liegt die Aufgabe der Gegenwart nicht darin, zur Perfektion zurückzukehren, sondern zur Verantwortung²⁹. Ein Künstler, der den Körper formt, muss wissen, was er auslässt. Ein Publikum, das den Körper betrachtet, muss lernen, was es sieht. Dazwischen könnte ein neuer Vertrag entstehen – nicht zwischen Banausen und Genies, sondern zwischen Sehenden und Gestaltenden.
Am Ende bleibt die Venus. Nicht die des Lüpertz, nicht die des Mythos, sondern die Vorstellung eines Körpers, der noch getragen ist von Sinn. Vielleicht steht sie irgendwo, unsichtbar zwischen Rathausplatz und Theater, im Schatten der Passanten. Vielleicht wartet sie darauf, dass jemand wieder hinsieht, nicht um zu glauben, sondern um zu erkennen. Kunst beginnt dort, wo Form und Blick sich wiederfinden. Ohne diesen Moment bleibt sie bloße Geste.
Fußnoten und Quellenverzeichnis
- Markus Lüpertz (*geb. 1941, Liberec*); vgl. Anja Osswald: Markus Lüpertz – Die Kunst, der Maler zu sein, Köln 2010.
- „Ich bin der letzte Genie-Künstler“, Die Zeit, Nr. 45/2015.
- Wolfgang Ullrich: Siegerkunst, Berlin 2016.
- Giorgio Vasari: Le Vite…, Florenz 1568, Kap. „Michelagnolo Buonarroti“.
- Antoinette Le Normand-Romain: Rodin. The Birth of Modern Sculpture, Paris 2004.
- Käthe Kollwitz: Tagebücher und Briefe, hrsg. J. Bohnke-Kollwitz, München 1989.
- Ingeborg Becker-Unseld, Käthe Kollwitz. Die Sprache der Hände, Berlin 2003.
- Margot Schmidt, Wilhelm Lehmbruck. Die Melancholie der Moderne, Düsseldorf 1991.
- Friedrich Schreyvogl, Ernst Barlach. Leben und Werk, Hamburg 1957.
- Penelope Curtis, Sculpture 1900–1945, Oxford 1999.
- Caroline Tisdall: Joseph Beuys, London 1979.
- Die 80er – Kunst der Gegenwart, Berlinische Galerie, 2000.
- Hans-Werner Schmidt, Baselitz, Penck & Co. Deutsche Kunst nach 1960, Leipzig 2008.
- Markus Lüpertz – Venus und Mythen, Museum Küppersmühle Duisburg, 2015.
- „Lüpertz-Venus sorgt für heftige Diskussionen“, Augsburger Allgemeine, 12.07.2021.
- Wolfgang Ullrich, Wahre Meisterwerte, Berlin 2017.
- „Die Venus kehrt zurück – Lüpertz-Skulptur in Augsburg wieder aufgestellt“, SZ, 25.08.2022.
- Brigitte Denninghoff (1923–2011) & Martin Matschinsky-Denninghoff (1921–2003), Kurzbiografie.
- Einweihung „Ostern“, Augsburger Allgemeine, 06.04.1992.
- Matschinsky-Denninghoff. Skulpturen 1958–2000, Kunstmuseum Bonn, 2000.
- Stadtarchiv Augsburg, Pressesammlung 1992, Rubrik „Kunst im öffentlichen Raum“.
- Stadt Augsburg, Dokumentation Kunst im öffentlichen Raum 1950–2010, Augsburg 2011.
- John Dewey: Art as Experience, New York 1934.
- Donald Sassoon, Culture of the Europeans, London 2006.
- Antoinette Le Normand-Romain, Les Bourgeois de Calais, Paris 1993.
- Käthe Kollwitz. Werkverzeichnis der Skulpturen, hrsg. A. v. d. Knesebeck, Berlin 2002.
- Boris Groys: Über das Neue, München 1992.
- Pierre Bourdieu, Die Regeln der Kunst, Frankfurt a. M. 1999.
- Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte?, München 1983.
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!




 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Markus Lüpertz Porträtkarikatur Public domain
Public domain






















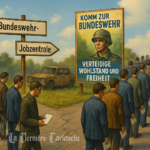 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche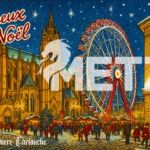 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 
Der wunderbare kleine Streifzug durch die alte Stadt Augsburg schaut auf zwei Werke öffentlicher Kunst im Stadtbild.
Der Autor stellt gegenüber :
die Pose, die Geste, die bloße Behauptung, die Syntax der Attitüde gegen den Gedanken,die Verantwortung, den Sinn.
Er kommt zu dem Schluss:
“Eine Stadt, die nach Identität sucht, trifft auf eine Kunst, die keine vermitteln will.”
“Die Augsburger wollten nicht weniger Kunst, sie wollten spüren, dass Kunst sie betrifft.”
Diese Vorgänge und die Kunstwerke sind sinnbildhafte Standarten des Niedergangs.
Aus der alten Zeit gibt es in Augsburg die Augsburger Prachtbrunnen , die zwischen 1588 und 1600 von Hubert Gerhard und Adriaen de Vries in Stein und Bronze geschaffen wurden.
Alle drei Brunnen wurden als Teile des „Augsburger Wassermanagement-Systems“ am 6. Juli 2019 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.
Das reicht der Stadt. Neues bringt sie nicht zuwege. Die Innenstadt verödet. Der Baubestand liegt in den Händen alter Clans, die die Mieten nach oben treiben und anstrengungslose Renten einschaufeln. Was kümmert es sie, dass das Gesicht der Stadt durch den von ihrer Raffgier erschaffenen Leerstand trostlos und hässlich wird? Was kümmert es die Stadtverwaltung, wenn sie für die Renovierung des Stadttheaters
( ebenso öde wie die Skulptur “Ostern” vor seinem Portal) 600 Millionen Euro rauswirft, während Eltern in den Ferien die Schultoiletten auf eigene Kosten renovieren müssen. Auch politische Posen und Posen bis zum Überdruß. Omnibusgroße Schreiplakate am Rathausplatz: “Nie wieder ist jetzt.”
Gefeiert werden soll damit Israel. Das passt zu dem Tatbestand, dass in Augsburg mehrere Rüstungsfirmen Produkte für den Einsatz beim Palästinenser metzeln herstellen. Die Stadt nennt sich “Friedensstadt” und schlägt sich in Gorillamanier brüllend auf die Brust. Dabei verdient sie mit an der Raserei und dem Gemetzel in Nahost.
Kein Wort und kein Gefühl für Palästina Nichts gelernt aus Hitlerdeutschland
Pose auch in der Umweltpolitik, in der Bürgerbeteiligung,etc.
Da ist Lüpertz das rechte, selbstverliebte und beliebige Augsburger Stadtmaskottchen.
Sie greifen den Gedanken des Textes auf und führen ihn weiter in die Wirklichkeit der Stadt – dahin, wo Kunst, Politik und Besitzverhältnisse ineinander greifen. Ihr Zorn ist berechtigt. Doch der Essay wollte weniger anklagen als erinnern: dass auch ein Gemeinwesen ohne innere Form verarmt. Lüpertz ist in diesem Sinn nicht Ursache, sondern Symptom – eine Stadt erkennt sich in der Kunst, die sie wählt.