![]()
Brosius-Gersdorff: Der Preis der Selbstermächtigung
Warum die Personalie Brosius-Gersdorff mehr ist als ein politischer Eklat
Die Verschiebung der Wahl Frauke Brosius-Gersdorffs zur Verfassungsrichterin hat nicht nur einen politischen Eklat ausgelöst, sondern offenbart tieferliegende Bruchlinien in der deutschen Demokratie. Was als formaljuristischer Vorgang begann, entwickelte sich zum Lackmustest für Prinzipientreue, Koalitionslogik und den Umgang mit den Grundfesten unserer Verfassungsordnung.
Die Ampel-Koalition ist Geschichte, regiert wird seither von einem CDU-Kanzler, gestützt auf eine fragile Mehrheit – die, wenn nötig, durch die Grünen und Teile der Linksopposition abgesichert wird. In dieser Lage kommt der Personalie Brosius-Gersdorff eine besondere Bedeutung zu: Sie steht nicht nur für eine klar linksliberale Lesart von Grundrechten, sondern auch für einen machtpolitischen Kuhhandel, der das Vertrauen in die Unabhängigkeit der höchsten juristischen Instanz beschädigen könnte.
Am 11. Juli 2025 wurde die geplante Wahl von Frauke Brosius-Gersdorff zur Verfassungsrichterin kurzfristig vertagt. Die offizielle Begründung: offene Fragen. Die inoffizielle, aber wahre: Die Koalition stand kurz vor dem Bruch. Die CDU wankte, die CSU verweigerte, und selbst im Kanzleramt roch man, dass man zu weit gegangen war. Die Wahl ist nun bis nach der Sommerpause ausgesetzt. Gut informierte Kreise vermuten: Brosius-Gersdorff wird nicht erneut vorgeschlagen.
Was bedeutet es, wenn Grundrechte als Privilegien verstanden werden?
Was, wenn das „C“ in CDU und CSU zur bloßen Worthülse verkommt?
Und was, wenn das Verfassungsgericht zur Bühne ideologischer Kompromisse wird?
Unser Herausgeber Louis de La Sarre hat sich in diesem Beitrag dieser Fragen angenommen – mit der Schärfe des aufgeklärten Zweifels und dem Ernst eines Menschen, der das Grundgesetz nicht für verhandelbar hält.
Doch wie kam es zu dieser Farce? Die Wahrheit ist so einfach wie erschütternd: Brosius-Gersdorff war nie eine Kandidatin des Ausgleichs, sondern ein Machtbaustein in einem ideologisch aufgeladenen Spiel. Sie wurde gezielt vorgeschlagen, um den linken Flügel – Linkspartei, linke SPD-Fraktionsteile und Grüne – zur Mehrheitsbeschaffung zu bewegen. Die Koalition, unter Führung eines CDU-Kanzlers, braucht für ihre Gesetzes- und Personalentscheidungen eine parlamentarische Mehrheit. Die AfD ist als Mehrheitsbeschaffer politisch ausgeschlossen. Das bedeutet: man öffnet sich rechnerisch nach links. Stillschweigend, aber systematisch.
Brosius-Gersdorff ist die Rechnung, die man der eigenen Machtgier hinterherschickt. Sie steht für eine Lesart des Grundgesetzes, in der Rechte konditioniert, nicht garantiert werden. In der „Freiheit“ nicht mehr ein Abwehrrecht gegen den Staat ist, sondern ein Bonus für Gehorsam. Wer sich nicht impfen lässt, dem sollen Freiheitsrechte „nicht so rasch zurückgewährt werden“, sagte sie wörtlich. Sie dachte laut darüber nach, ob es eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Impfpflicht geben könne. Sie forderte die finanzielle Benachteiligung Ungeimpfter in der gesetzlichen Krankenversicherung – zu einem Zeitpunkt, als längst klar war, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben. Das ist kein medizinisches Argument mehr. Das ist soziale Exklusion unter pseudorechtlichem Deckmantel.
Und nun soll genau diese Frau, die Grundrechte nach Nützlichkeit sortiert, das Bundesverfassungsgericht mitprägen? Ausgerechnet in einer Koalition, die sich christlich nennt?
Hier liegt der eigentliche Skandal. Die CSU, die noch den Anspruch erhebt, christliche Werte zu vertreten – Lebensschutz, Menschenwürde, Unversehrtheit – trägt eine Nominierung mit, die im Kern nicht nur mit dem „C“ unvereinbar ist, sondern offen gegen die Lehre der katholischen Kirche steht. Brosius-Gersdorff vertritt die These, dass ein Kind zwei Minuten vor der Geburt keine Menschenwürde besitzt. Sie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie §218 des Strafgesetzbuchs zur Disposition stellt. Und dennoch sagt Kanzler Merz auf die Frage, ob er ihre Wahl mit seinem Gewissen vereinbaren könne, lediglich: „Ja.“ Mehr nicht. Kein innerer Riss, keine Differenz, keine Spannung zwischen Gewissen und Koalition. Nur ein kalkulierter Satz. Es ist ein politischer Offenbarungseid.
Man kann die Grünen verstehen. Sie sind keine Partei christlicher Herkunft, sondern eine Partei säkularer Moral. Sie kämpfen offen für ihre Vision, und sie spielen das Spiel mit Machtinstinkt. Sie setzen Personen wie Brosius-Gersdorff ein, um die Deutungshoheit über Freiheit, Gerechtigkeit und Verfassung zu gewinnen. Was man ihnen vorwerfen kann, ist nicht Scheinheiligkeit, sondern Konsequenz. Aber von einer Union, die sich noch immer „C“ auf die Stirn schreibt und dabei bereit ist, jedes Prinzip für parlamentarische Restmehrheiten aufzugeben, ist das kein Spiel. Es ist Verrat.
Dass heute nicht gewählt wurde, ist allein dem Protest aus den wertgebundenen Reihen zu verdanken – nicht aus moralischer Entrüstung, sondern aus strategischem Überlebenstrieb. Und ja: es war Jens Spahn, der den Plagiatsverdacht in letzter Minute öffentlich machte – nicht etwa als Hüter der Wissenschaftsethik, sondern als Zünder einer kontrollierten Verzögerung.
Und was Brosius-Gersdorff selbst betrifft: Ihre Sprache ist verräterisch. In Interviews spricht sie von „Verbotsverfahren“, von der Notwendigkeit, „Verfassungsfeinde zu beseitigen“, von einer Demokratie, die sich „wehren“ müsse. Es ist der Tonfall der ultimativen Legitimation. Wer nicht passt, wird nicht gehört. Wer nicht gehorcht, wird entmenschlicht. Dass diese Denkweise von einem Organ wie dem Bundesverfassungsgericht ausgeht, wäre das Ende jeder vertrauenswürdigen Gewaltenteilung.
Die neue Reproduktion: Wenn der Leib zur Dienstleistung wird
Ein weiteres Beispiel für Brosius-Gersdorffs juristisch-technokratische Grundhaltung zeigt sich in ihrer Befürwortung von Leihmutterschaft und Eizellspende – beides in Deutschland bislang verboten, aus gutem Grund: Weil sie die personale Dimension von Mutterschaft zerlegen und den weiblichen Körper in Funktionen aufspalten. Brosius-Gersdorff spricht von „altruistischen Modellen“. In Wahrheit ist es ein Denken in Reproduktionslogistik: der Körper als austragender Dienstleister, das Kind als intentional erzeugte Vertragsware, die Bindung als juristisch definierte Zuständigkeit. Mutterschaft wird nicht mehr als gelebte Einheit verstanden, sondern als segmentiertes Arrangement.
Die Person wird zur Plattform. Der Leib wird entkörpert. Das Kind verliert seinen Status als Gabe und wird zur geplanten Größe im Raster funktionaler Ansprüche. Diese Logik ist nicht postmodern, sondern posthuman.
Wenn das Kopftuch als Symbol der Neutralität gilt
Noch absurder wird es im staatsrechtlichen Bereich: Brosius-Gersdorff kritisiert das Kopftuchverbot im Justizdienst als verfassungswidrig. Doch wo das Symbol religiöser Unterordnung im Namen der Diversität gerechtfertigt wird, verliert der Staat seine Identität. Die säkular-westliche Ordnung war nie neutral gegenüber dem Anspruch religiöser Machtzeichen – sie war schützend zurückhaltend, weil sie mit Gedächtnis und Maß gestaltet war. Ihre Position ist daher naiv multikulturalistisch und verkennt die strukturelle Asymmetrie religiöser Sichtbarkeit.
Gleichstellung als statistischer Zwang
Auch ihre Gleichstellungspolitik folgt keinem personalen Ethos, sondern einer Zähl-Logik. Paritätsgesetze, unabhängig von Kandidatenlage oder Wählerwillen, verwandeln den Menschen in eine zu verteilende Größe. Hier ist nicht mehr von Gleichwertigkeit die Rede, sondern von soziologistischer Reduktion – mit totalitärer Versuchung.
Die Absurdität einer moralischen Umkehr: „Unchristlich“ ist der Bischof?
Ein Detail zeigt die Absurdität besonders deutlich: Als der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl öffentlich Zweifel an der ethischen Vertretbarkeit dieser Personalie äußerte, beschuldigte ihn SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch, sich an einer „unchristlichen Hetze“ zu beteiligen. Das ist mehr als ein rhetorischer Ausrutscher. Es ist der Versuch, ausgerechnet jenen das Christentum abzusprechen, die sich noch an dessen Gebote erinnern. Wer das Leben verteidigt, gilt als extrem. Wer es zur Verfügung stellt, als fortschrittlich. Das ist die moralische Verkehrung, die dieser Personalentscheidung zugrunde liegt.
Diese Aussage ist kein Ausrutscher, sondern Ausdruck einer in sich geschlossenen Lebensanschauung, die Brosius-Gersdorff und Miersch gleichermaßen vertreten: Der Mensch ist, was er will. Nichts ist heilig außer dem Willen. Kein Maß, keine Bindung, keine Grenze darf dem Primat der Selbstverfügung im Wege stehen.
Ein Menschenbild auf Abruf
Was sich hier zeigt, ist mehr als ein Streit um eine Personalie. Es ist der Kampf um die letzte Definition des Menschen im Recht. In Brosius-Gersdorffs Denken ist das Recht nicht mehr in der europäischen Vernunfttradition verankert, sondern gelöst von jeder metaphysischen Bindung. Es ist kein Ausdruck von Verantwortung, sondern ein Instrument der gesellschaftlichen Verfügbarkeit.
Das hat System: Die Menschenwürde wird relativiert, das Lebensrecht fragmentiert, der Körper verfügbar gemacht, die Religion zur Gleichformel, das Geschlecht zur Zahl. Was bleibt, ist nicht die Freiheit der Person, sondern die Allmacht des Willens. Das ist nicht Fortschritt. Es ist die technokratische Entwurzelung des Humanen.
Und es wird Zeit, dass wir es als das benennen, was es ist: eine stille, aber entschlossene Abkehr vom Menschen – mit verfassungsanthropologischer Sprengkraft.
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!




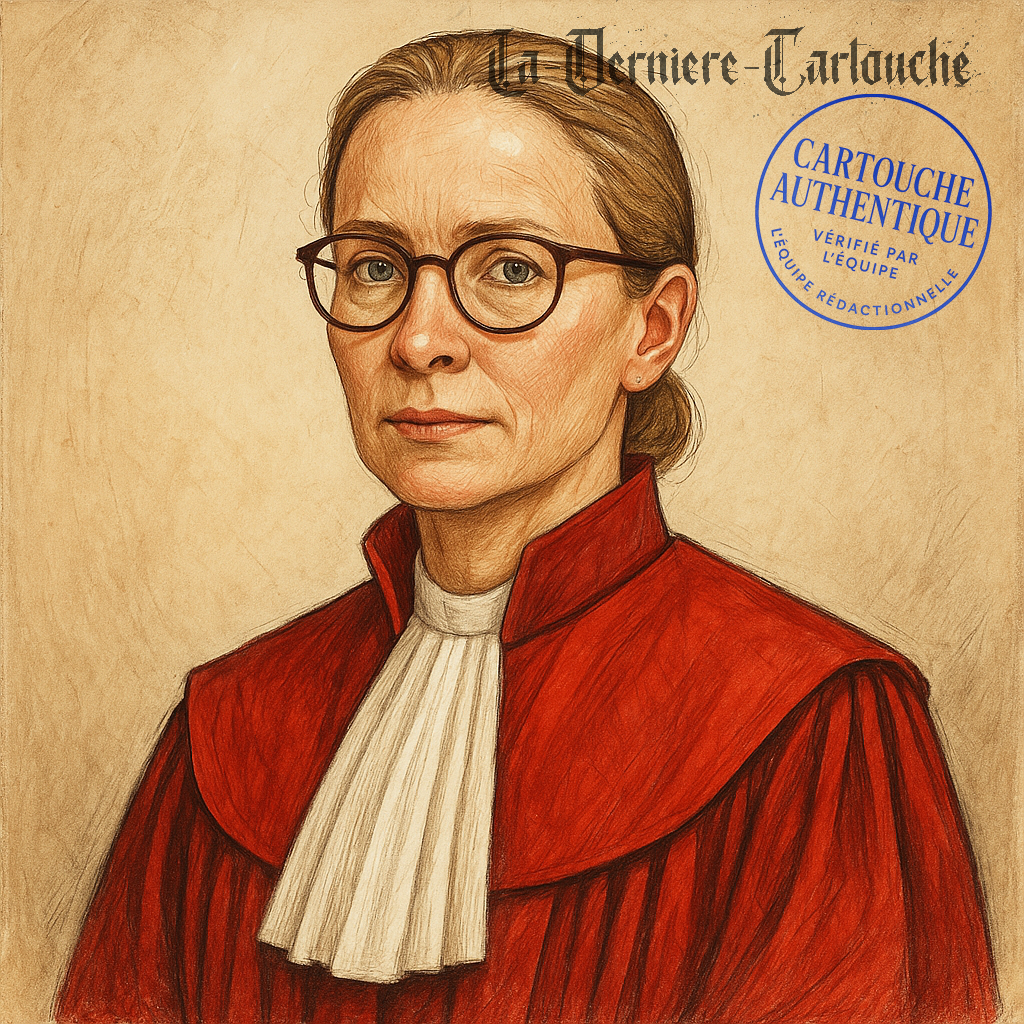

 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















Ich kann hier nicht jeden Gedankengang unterstreichen, sehe aber sehr einen gut durchdachten Text, der zur Debatte herausfordert. Und geneu die benötigen wir so dringend.
Sehr geehrter Herr Sperl,
herzlichen Dank für Ihre prägnanten und durchdachten Kommentare, insbesondere zu meinen jüngsten Ausführungen. Einer Ihrer Hinweise, der mir besonders ins Auge stach, war der Verweis auf den „Gödelschen Satz“. Ich muss gestehen, dass dieser Gedanke – die Idee eines in sich widersprüchlichen Systems oder einer Aussage, die das System, in dem sie formuliert wird, in seinen Grundfesten erschüttert – genau das war, was ich zur Untermauerung meiner Analyse zu Frauke Brosius-Gersdorf im Sinn hatte, doch wollte er mir im entscheidenden Moment nicht einfallen. Ihr Kommentar war somit ein glücklicher Umstand, der es mir ermöglichte, diesen präzisen logischen Bezugspunkt nun nachträglich in meine Argumentation zu integrieren.
Meine Auseinandersetzung mit der Position von Frau Brosius-Gersdorf, insbesondere ihrer Aussage zur Menschenwürdegarantie „erst ab Geburt“, konzentrierte sich darauf, diese als einen logischen Bruch innerhalb der axiomatischen Struktur des Grundgesetzes zu begreifen. Artikel 1 Absatz 1 GG, mit der Feststellung „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, ist für mich ein unverhandelbares Axiom. Es ist die Grundprämisse, die ohne Ausnahme gilt und das gesamte Normengebäude trägt.
Die Formulierung einer Ausnahme, wie „erst ab Geburt“, innerhalb eines Systems, das sich durch absolute Geltung ohne Ausnahme definiert, erzeugt nach meinem Verständnis einen Selbstwiderspruch, der frappierend an die Struktur eines Gödelschen Satzes erinnert. Das System Grundgesetz postuliert die Unantastbarkeit der Menschenwürde als universelles, nicht zeitlich oder entwicklungsbiologisch gebundenes Prinzip. Eine Aussage, die dies relativiert oder zeitlich konditioniert, fungiert hier als jener interne Widerspruch, der die Konsistenz des Systems in Frage stellt, ohne es explizit zu verlassen. Es ist der Versuch, eine Bedingung in eine absolute Setzung einzuführen, wodurch die Absolute ihren Charakter verliert.
Ihr Hinweis auf den Gödelschen Satz hat mir dabei geholfen, diese verfassungsphilosophische Inkonsistenz mit der notwendigen logischen Schärfe zu fassen. Er verdeutlicht, warum eine solche Position nicht als legitimer Auslegungsspielraum, sondern als eine implizite Aufkündigung der Axiomatik verstanden werden muss. Wenn die höchsten Ausleger des Grundgesetzes – insbesondere Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts – solche Widersprüche dulden oder gar vertreten, dann gefährdet dies die Integrität und die Vertrauenswürdigkeit des gesamten Verfassungssystems. Denn das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit basiert auf der Erwartung, dass die fundamentalen Prinzipien des Grundgesetzes unverbrüchlich sind und nicht intern ausgehöhlt werden können.
Ihre Anmerkung, dass ein solcher Text zur „Debatte herausfordert“ und diese „dringend benötigt“ wird, trifft den Nagel auf den Kopf. Gerade in Zeiten, in denen verfassungsrechtliche Grundsätze scheinbar zunehmend zur Disposition stehen, ist eine präzise und logisch stringente Auseinandersetzung unerlässlich. Es geht darum, die Konsequenzen von Positionen, die das Fundament unseres Rechtssystems berühren, in ihrer ganzen Tragweite zu erkennen und zu benennen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Impulse, die meine Analyse maßgeblich bereichert haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Louis de la Sarre