![]()
Wolfram Weimer – Architekt der Öffentlichkeit
Ein Porträt
Unbequeme Stimmen
Anmerkung zur Porträtreihe
Es gibt eine stille Sehnsucht nach Zustimmung. Politik, Medien, Kultur – sie alle lieben den Gleichklang,
die wohltemperierte Melodie, die niemandem wehtut. Doch eine Gesellschaft, die nur im Chor singt, verliert ihre Stimmen.
Die interessantesten Figuren sind meist jene, die sich weigern, mitzusingen. Sie sind unbequem, sperrig, manchmal anstrengend.
Sie stören den Konsens und riskieren die Isolation. Doch gerade darin liegt ihre Bedeutung: Sie erinnern uns daran,
dass Freiheit nicht im Applaus besteht, sondern im Widerspruch.
La Dernière Cartouche nimmt sich dieser Stimmen an. Nicht um sie zu feiern, nicht um sie zu verurteilen –
sondern um sie zu verstehen. Wir porträtieren Persönlichkeiten, die ihre eigene Meinung haben und sie nicht verbergen.
Menschen, die in einem Klima der Harmonisierung den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen.
Die ersten drei Porträts zeigen die Spannweite dieses Typus:
- Wolfram Weimer, den Architekten der Öffentlichkeit, der Medien baut wie andere Häuser und an die Kraft der Symbole glaubt.
- Boris Palmer, den Bürgermeister im Sturm, der Politik als Handwerk begreift und Tabus nicht scheut.
- Henryk M. Broder, den Stachel im Fleisch, der mit Ironie und Polemik jede Bequemlichkeit zerschneidet.
Drei Stimmen, drei Biographien, drei Stile – vereint durch eines: Sie sind nicht zu vereinnahmen. Sie sind unbequem.
Und genau das macht sie für uns interessant.
Denn eine Gesellschaft, die solche Figuren verliert, verliert auch ihre Streitkultur. Und ohne Streit gibt es keine Freiheit.
Wolfram Weimer – Architekt der Öffentlichkeit
Ein Porträt
An einem Wintermorgen am Tegernsee: die Sonne liegt wie ein Versprechen über den Bergen, im Hotelzimmer klimpern die Gläser, draußen warten die Kameras. Drinnen spricht Wolfram Weimer über Deutschland. Er tut es nicht als Politiker, nicht als Gelehrter, sondern als etwas dazwischen – als ein Mann, der die Öffentlichkeit liebt und sie gleichzeitig als Werkstoff begreift. Er weiß, dass Worte Räume bauen können. Er weiß, dass ein „Gipfel“ mehr ist als eine Konferenz: Es ist ein Bild, das hängenbleibt.
So könnte man ihn sehen, diesen 1964 geborenen Sohn aus Gelnhausen: als Architekten der Öffentlichkeit. Seine Karriere – von der Schülerzeitung „Der schwarze Elch“ bis zum Staatsminister für Kultur und Medien – ist nicht die Geschichte eines linearen Aufstiegs. Sie ist die Geschichte eines Mannes, der immer wieder neue Räume schaffen wollte, um die Gesellschaft in Bewegung zu setzen.
Der Intellektuelle im Unternehmer
Weimer studierte Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaft, Volkswirtschaft. Die Mischung verrät schon die Richtung: Er ist kein Fachspezialist, sondern ein Sammler von Perspektiven. Seine Dissertation über die Bank of North America klingt trocken – doch sie zeigt ein Muster: die Neigung, ökonomische und politische Fragen in einem größeren Zusammenhang zu denken.
Früh aber zog es ihn in die publizistische Praxis. Welt, Berliner Morgenpost, Focus: Namen, die nach Leitmedien klingen. Doch das genügte ihm nicht. Er wollte kein Chefredakteur unter vielen sein, er wollte ein neues Medium erschaffen. So entstand 2004 Cicero. Ein intellektuelles Politikmagazin, klug positioniert, elegant im Auftritt. Vielleicht eine der letzten echten Magazin-Neugründungen, die Bestand hatten.
Es ist dieses Unternehmertum, das ihn auszeichnet: nicht das Bewahren, sondern das Erfinden. Der moderne Gestalter, den Weimer verkörpert, ist kein nostalgischer Hüter der Vergangenheit, sondern ein Architekt neuer Formate. Er denkt in Marken, in Netzwerken. Er gründet, wenn andere verwalten.
Der konservative Liberale
Weimers politische Haltung wirkt in Deutschland fast exotisch. Er ist konservativ-liberal – eine Kombination, die sich nicht auf der Achse links-rechts fixieren lässt. Er misstraut den großen Erzählungen der Gegenwart: dem Klima-Apokalyptizismus, dem moralischen Ton der Migrationspolitik, der wohlfeilen Identitätspolitik. Stattdessen betont er ökonomische Vernunft, historische Erfahrung, nüchterne Analyse.
Man könnte sagen: Er denkt wie ein Historiker und redet wie ein Unternehmer. Seine Argumente sind nicht revolutionär, sondern widerständig. Er sagt, was viele nicht sagen wollen: dass der menschengemachte Klimawandel nicht alles erklärt, dass Migration auch Ordnung braucht, dass Moral nicht die Grundlage von Politik sein darf.
Damit macht er sich angreifbar. Die einen sehen in ihm den intellektuellen Stichwortgeber eines neoliberalen Projekts, der alten Marktglauben mit neuem Glanz versieht. Die anderen schätzen ihn als Stimme, die gegen den Strom schwimmt, weil sie nicht im Strom untergehen will.
Der Netzwerker der Symbole
Weimer versteht etwas, was in der heutigen Politik selten geworden ist: die Macht der Inszenierung. Ein Gipfel am Tegernsee – das ist nicht nur ein Treffen von Entscheidern, es ist ein Symbol. Die Alpenkulisse verleiht Schwere und Würde, die Fotografen liefern die Bilder, die Zitate die Schlagzeilen.
In dieser Symbolsprache zeigt sich sein Wesen: Er schafft Foren, er schafft Medien, er schafft Gesprächsräume. Er baut nicht nur Inhalte, er baut Atmosphären. Darin gleicht er weniger einem Verleger alter Schule als einem Regisseur, der die Bühne so setzt, dass die Akteure strahlen können.
Doch hier liegt auch die Ambivalenz: Wer Atmosphären baut, wird verdächtigt, die Substanz zu vernachlässigen. Kritiker fragen, ob hinter dem schönen Schein auch Tiefe steckt. Weimer selbst würde antworten: Substanz allein reicht nicht – sie braucht die Form, um zu wirken.
Der Staatsminister
2025 trat Weimer in eine neue Rolle: Staatsminister für Kultur und Medien. Plötzlich steht er nicht mehr als Kommentator am Rand, sondern trägt Verantwortung im Zentrum. Ein Medienunternehmer, der nun den Kulturhaushalt verwaltet. Ein Publizist, der nun zum Kulturpolitiker geworden ist.
Das ist ein riskanter Rollenwechsel. Kann jemand, der immer auch Partei war, plötzlich der neutrale Vermittler sein? Wird er zum Verteidiger der Freiheit der Presse, oder eher zum Ökonomisierer der Kulturpolitik? Seine Gegner warnen vor Letzterem, seine Anhänger hoffen auf Ersteres.
Hier wird sichtbar, wie sehr Weimer polarisiert. Er ist nicht der unauffällige Bürokrat, den man an solchen Stellen erwartet. Er ist ein Intellektueller mit Haltung, ein Unternehmer mit Ideen. Ob das zum Segen oder zum Problem wird, ist noch offen.
Ambivalenz als Signatur
Das Porträt dieses Mannes bleibt ambivalent – und vielleicht ist das die ehrlichste Form, es zu schreiben. Weimer ist Intellektueller und Unternehmer zugleich, konservativ und modern, provozierend und verbindend. Er hat Foren geschaffen, in denen andere reden, und zugleich selbst immer das letzte Wort gesucht.
Er ist ein Gestalter, nicht weil er die Vergangenheit verklärt, sondern weil er die Gegenwart ernst nimmt – mit all ihrer Unübersichtlichkeit. Seine Modernität liegt in der Form, seine Konservativität in der Haltung.
Wenn er nun sagt, die AfD werde 2029 unter zehn Prozent fallen, dann zeigt sich noch eine weitere Facette. Weimer wagt Prognosen, wo andere nur Trends beschreiben. Er glaubt an die Selbstheilungskräfte des politischen Systems, an die Vernunft der Wähler und an die Rückkehr der Ordnung. Vielleicht täuscht er sich. Vielleicht bleibt die AfD stärker, vielleicht zerbricht die Logik seiner Kurven. Doch gerade in diesem Optimismus liegt sein Wesen: Er rechnet mit der Krise, aber er setzt nicht auf den Untergang.
Wolfram Weimer ist ein Architekt der Öffentlichkeit, und Architekten bauen Räume, die größer sind als sie selbst. Manche Räume halten, andere stürzen ein. Ob auch seine Prognosen tragen werden, das wird sich zeigen. Sicher ist nur: Er bleibt eine Figur, die im Widerspruch lebt – und daraus ihre Kraft zieht.
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!




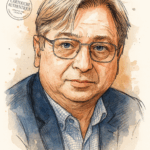 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS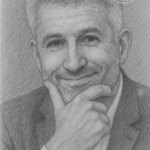 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS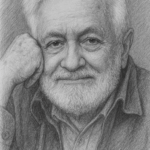 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Gewundert hat mich, dass er sich gegen die neuere europäische Wurst-Sprach-Politik gewandt hat. Dafür verdient er Respekt. Die Sprachkritik schätzt Sprache nämlich völlig falsch ein.