Summary
Einst galten Intellektuelle als Störenfriede der Macht, als Unruhestifter im Namen der Wahrheit. Heute herrscht Stille. Étienne Valbreton fragt, warum die kritische Elite verstummt ist – und ob es noch Orte gibt, an denen Denken nicht angepasst, sondern notwendig ist.
![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Die Intellektuellen sind müde
– Wo ist die kritische Elite geblieben?
Die Intellektuellen sind müde – Wo ist die kritische Elite geblieben?
Es ist still geworden. Still in jenen Kreisen, aus denen einst das gedankliche Raunen kam, das den Fundamenten der Macht einen feinen, aber wirkungsvollen Riss zufügte. Wo früher Namen wie Bourdieu, Derrida, Adorno oder Barthes die Ordnung befragten, spürt man heute vor allem Abwesenheit. Die großen Essays, die einst das Intellektuelle mit dem Politischen und das Politische mit dem Poetischen verbanden, sind verblasst im Widerschein einer Welt, die keine langen Sätze mehr duldet und kein Zögern mehr erlaubt.
Was ist geschehen mit den Denkern, die unbequem waren? Jenen, die sich nicht in Positionen einreihten, sondern Fragen stellten, die keine Antworten suchten – sondern Räume öffneten. Die Müdigkeit der Intellektuellen ist keine biologische, sie ist strukturell. Ihre Erschöpfung kommt nicht vom Alter, sondern von einem kulturellen Klima, das Reflexion in Verdacht nimmt und Zweifel als Illoyalität taxiert. Wer heute zögert, wird überholt; wer differenziert, wirkt verdächtig; wer sich dem Konsens verweigert, gerät unter Verdacht – nicht des Irrtums, sondern der Feindseligkeit.
Die neue Öffentlichkeit duldet keine Dissonanz. Sie verlangt Haltung, sofort und eindeutig. Die alte Geste des intellektuellen Zauderns, des Abwägens, des tastenden Denkens hat darin keinen Ort mehr. Die sozialen Netze, einst als Möglichkeitsräume der Emanzipation gefeiert, sind längst zu vollautomatisierten Regimetheatern geworden. Hier spielt nicht, wer denkt, sondern wer sendet. Der Intellektuelle als Figur der zweiten Stufe – jemand, der beobachtet, bevor er spricht – ist zu langsam für die Taktung der Gegenwart.
Gleichzeitig hat sich das Verhältnis zur Wahrheit verschoben. Wahrheit, einst Gegenstand diskursiver Ringkämpfe, ist heute oft nur noch eine Frage der Reichweite. Die kritische Elite, die sich einst an der Schnittstelle zwischen Erkenntnis und Gesellschaft bewegte, wirkt wie aus der Zeit gefallen. Einige haben sich zurückgezogen, andere auf Seiten gewechselt – nicht politisch, sondern semantisch. Sie sprechen nun in Formaten, die ihnen fremd sind. TED-Talks statt Traktate, Panels statt Pamphlete. Der Preis dieser Anschlussfähigkeit ist hoch: Gedanken werden zu Statements, Fragmente zu Marken, Haltung zu Ware.
Der Rückzug ist aber nicht nur individuell. Er ist auch institutionell. Die Orte, an denen früher kritisches Denken kultiviert wurde – Universitäten, Zeitschriften, Theater, Buchhandlungen –, sind selbst zu Agenturen des Konsenses geworden. Wer heute in einer Universität eine unzeitgemäße Frage stellt, riskiert weniger Widerspruch als Unsichtbarkeit. Der akademische Betrieb produziert Paper, keine Gedanken. Und die Kulturkritik, einst das Flirren zwischen Ästhetik und Gesellschaft, ist vielfach zu einem feinnervigen Feuilletonismus verdunstet, der gut riecht, aber nichts mehr bewegt.
Doch vielleicht ist es zu einfach, nur die Strukturen zu beschuldigen. Vielleicht haben auch die Intellektuellen selbst verlernt, unbequem zu sein. Vielleicht waren sie zu lange Teil des Spiels, zu sehr im Dialog mit der Anerkennung. Der Verlust der Außenseiterposition wiegt schwer. Wer immer eingeladen wird, hat bald nichts mehr zu sagen, was stört. Wer immer gefragt wird, verlernt das Verstummen – und mit ihm das Denken. Die kritische Elite war einmal eine störende Kraft. Heute scheint sie vielerorts integriert, reguliert, assimiliert.
Aber da ist ein Rest. Ein leises Nachleuchten. Es gibt sie noch, die Stimmen, die nicht flach geworden sind, die nicht senden, sondern fragen. Sie schreiben in Rändern, veröffentlichen in kleinen Verlagen, sprechen in Räumen ohne Mikrofone. Ihre Kraft liegt gerade in der Unsichtbarkeit. Vielleicht beginnt von dort etwas Neues. Kein Aufstand, keine Bewegung, keine Mode – nur ein zäher, unmerklicher Widerstand gegen das Vergessen, gegen die Selbstverständlichkeit des Systems.
Es ist zu früh, sie aufzugeben. Doch wer sucht, wird sie kaum auf Bühnen finden. Man muss sie lesen wie Fußnoten in einer lauten Welt. Man muss lernen, wieder zu lauschen, bevor man spricht. Nur dann kann das Denken zurückkehren – nicht als Pose, sonern als innere Notwendigkeit. Und mit ihm vielleicht auch jene, die nie verschwanden, sondern nur zu leise waren für eine Zeit, die schreit.
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!



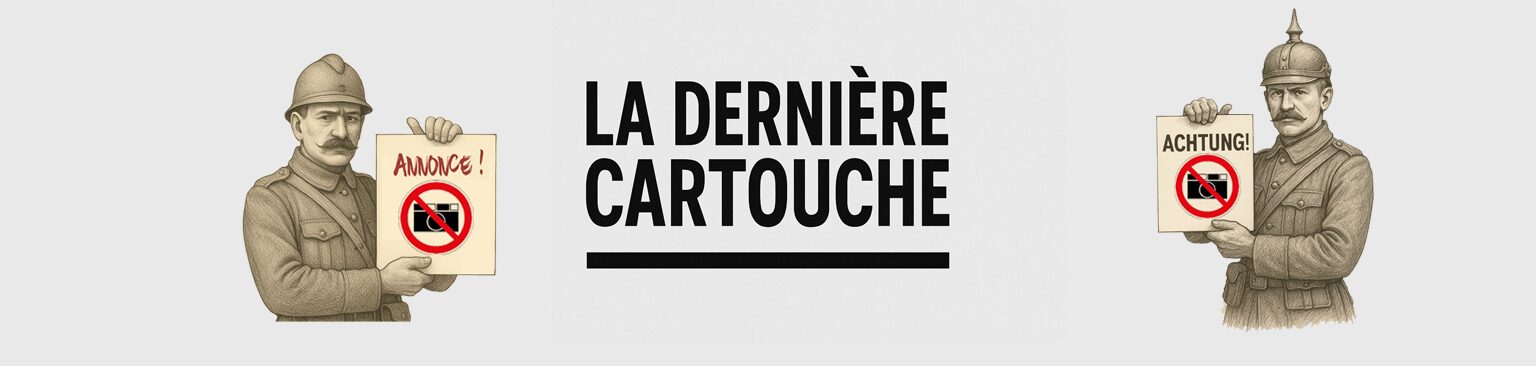



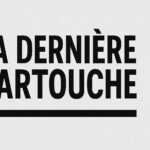 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Ihr Text bringt eine Wahrheit auf den Punkt, die viele zu übersehen scheinen: Die Intellektuellen sind nicht nur müde – sie sind verschwunden aus dem öffentlichen Diskurs, der sich immer mehr auf schnelle Meinungen und mediale Selbstdarstellung reduziert. Die kritische Elite, die einst das Fundament des Denkens erschütterte, wirkt heute oft wie eine nostalgische Erinnerung.
Was mich besonders beschäftigt: Ist es wirklich nur das „strukturelle Klima“, das sie zum Schweigen bringt? Oder haben die Intellektuellen sich zu sehr an die Spielregeln der Gegenwart angepasst und damit ihre Unabhängigkeit eingebüßt? Ihre Diagnose zeigt, wie dringend wir neue Räume brauchen – für Fragen statt Antworten, für Zweifel statt Gewissheiten.
Ich würde mich freuen, wenn Sie darüber schreiben würden, wie diese Räume konkret entstehen können oder ob wir bereits mitten in einem langsamen, aber beharrlichen Aufbruch stecken, der nur noch kaum hörbar ist.
Vielen Dank für diesen klarsichtigen und ehrlichen Kommentar. Ihre Frage trifft ins Herz der Debatte: Liegt das Verschwinden der Intellektuellen allein am „strukturellen Klima“ – oder haben sich viele längst den Bedingungen einer Aufmerksamkeitsökonomie unterworfen, die kaum Platz lässt für Ambivalenz, Langsamkeit oder theoretische Tiefe?
Tatsächlich scheint es nicht nur eine äußere Erschöpfung zu geben, sondern auch eine innere Selbstpreisgabe. In dem Moment, wo Intellektuelle beginnen, ihre Relevanz über Reichweite oder Anschlussfähigkeit zu definieren, verlieren sie jene Distanz, aus der Kritik überhaupt erst möglich wird. Die Ränder – einst Orte des Denkens – sind medial besetzt, vermessen, ausgeschildert. Und wer dort noch sprechen will, wird schnell vereinnahmt oder diffamiert.
Ob es neue Räume gibt? Vielleicht nicht sichtbar, nicht laut. Aber es existieren Orte der Sammlung – kleine, unabhängige Publikationen, marginalisierte Lehrstühle, Gesprächskreise, digitale Inseln des Zweifels. Nicht als heroische Avantgarden, sondern als fragile Möglichkeitsbedingungen. Vielleicht ist dieser leise Aufbruch, von dem Sie sprechen, tatsächlich schon im Gange – nur dass er sich der Sichtbarkeit bewusst entzieht.
Die Frage bleibt, wie wir diesen Raum nicht nur verteidigen, sondern produktiv machen können: für Unfertiges, für intellektuelle Unbequemlichkeit, für eine Wiederkehr der Haltung. Danke, dass Sie diesen Gedanken öffentlich gemacht haben.
Etienne