![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Lothringens verlorene Kraft
Vom Muskel Frankreichs zur Randprovinz
Hinweis
Dieser Beitrag ist als Fortsetzung zu meinem Essay „Die wahre Melkkuh“ zu lesen. Dort ging es um das Saarland – eine Region, die nach 1957 zur Energiequelle der Bundesrepublik wurde und dennoch verarmte, weil ihre Erträge andernorts verbucht wurden. Hier richtet sich der Blick über die Grenze, nach Lothringen, wo sich unter französischem Vorzeichen dasselbe Muster wiederholte.
Im Saarland war der Mechanismus des Niedergangs ein Ergebnis föderaler Umverteilung – die Logik des Länderfinanzausgleichs, der aus Solidarität ein strukturelles Gefälle machte. In Lothringen hingegen entsprang die Schwächung dem Zentralismus: einer politischen Ordnung, die Kraft aus der Peripherie zieht und sie zugleich entmündigt.
Lothringen war keine gewöhnliche Provinz. Es war eine Werkstatt, in der Frankreich seine moderne Kraft formte. Jahrzehntelang lieferte diese Region Erz, Energie und Arbeitskraft – das Material, aus dem die Republik ihren industriellen Aufstieg schmiedete. Zwischen Metz, Thionville, Hayange und Longwy spannte sich ein Gürtel aus Gruben und Hochöfen, das Rückgrat der Nation. Schornsteine wurden zu Wahrzeichen, das Rauschen der Hochöfen zum Pulsschlag einer ganzen Epoche. Die französische Republik verdankte dieser Region einen wesentlichen Teil ihres modernen Gesichts, doch Paris sah nach Osten vor allem, um zu nehmen. Lothringen war unentbehrlich und zugleich suspekt – zu produktiv, zu eigenwillig, zu nah an Deutschland. Wer gebraucht wird, ohne wirklich dazuzugehören, bleibt immer unter Beobachtung.
In den fünfziger Jahren galt die minette, das eisenhaltige Gestein des lothringischen Bodens, als Versprechen nationaler Größe. Millionen Tonnen Erz wurden gefördert und verhüttet, gebändigt durch Technik und Disziplin. Die Männer trugen Helme aus Stahl, die Frauen hielten den Haushalt der Industriegesellschaft zusammen. Lothringen war der Muskel Frankreichs, doch der Kopf, der ihn lenkte, saß in Paris.
Als in den siebziger Jahren die Krise kam, veränderte sich die Welt. Der internationale Stahlmarkt brach ein, Ölpreise explodierten, neue Erzvorkommen in Brasilien und Afrika machten die lothringische minette über Nacht zu einem teuren Relikt. Überall musste reagiert werden – in Deutschland, in Belgien, in Luxemburg. Auch Frankreich reagierte, doch auf seine Weise: zentralistisch, technokratisch, fern der betroffenen Orte. Die Regierung versprach Planung und brachte Verwaltung, versprach Strukturwandel und lieferte Stilllegung. Die Hütten von Longwy, Joeuf, Hayange und Florange schlossen nicht, weil die Minen erschöpft waren, sondern weil sie aus den nationalen Kalkulationen fielen. Ihre Öfen hätten weiter brennen können – mit Investitionen, mit Mut, mit Vertrauen. Doch in Paris entschied man, dass sich das Feuer nicht mehr lohne. Die Welt wurde global, Frankreich blieb hierarchisch. Die Region wurde beruhigt, nicht erneuert.
Was danach kam, nannte man Neugliederung. 2016 verschwand Lothringen in der neuen Großregion Grand Est – ein bürokratischer Akt, elegant verpackt, kulturell verheerend. Straßburg erhielt die Verwaltung, Metz den Trost der Erinnerung. Eine Region, die einst stolz genug war, sich mit Paris anzulegen, wurde zur Verwaltungseinheit ohne Stimme. Und doch: Wer heute durch das Tal der Fensch fährt, jenes enge Industrietal westlich von Thionville, in dem Hayange, Nilvange und Florange liegen, spürt, dass hier etwas weiterlebt. Die alten Industriestädte sind kleiner geworden, aber nicht leer. Die Fassaden sind gealtert, doch in den Cafés reden Menschen, die wissen, was Arbeit einmal bedeutete. Die Sprache hat ihren rauen Ton verloren, doch der Wille, gehört zu werden, ist geblieben.
Die Parallele zur Saar liegt offen zutage. Beide Regionen gaben mehr, als sie zurückbekamen. Beide wurden zu Versuchsfeldern nationaler Politik. Und beide zeigen, wie Macht funktioniert: zentral, anonym, selbstgewiss. Die Grenze trennt nicht das Schicksal, sondern nur die Sprache, in der man es erzählt. Vielleicht liegt genau darin die Lehre. Europa scheitert nicht an zu vielen Regionen, sondern an zu wenig Verständnis für sie. Wer aus der Mitte regiert, sieht leicht über den Rand hinweg. Doch das Eigentliche geschieht immer dort, wo etwas versiegt – Energie, Vertrauen, Hoffnung.
Lothringen war keine arme Provinz. Es wurde arm gemacht – durch politische Entfernung. Und wenn man heute von Wiederbelebung spricht, klingt es wie Hohn auf eine Region, die ein Jahrhundert lang das Blut der Republik lieferte und am Ende wie eine verbrauchte Maschine stillgelegt wurde. Vielleicht ist das die zweite Melkkuh Europas: jene Landschaften, die man einst für unerschöpflich hielt und deren Leere man nun mit Programmen füllt. Sie sind der Preis der zentralistischen Vernunft und die Erinnerung daran, dass Solidarität ohne Nähe nur Verwaltung ist.





 Symbolbild / KI-generierte Illustration Redaktion La Dernière Cartouche
Symbolbild / KI-generierte Illustration Redaktion La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)
© La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.) © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 





















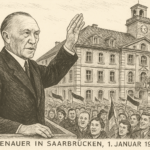
 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.