![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Der Aufstieg der AfD und die politische Krise in Deutschland: Eine Beobachtung aus der Ferne
Eine Beobachtung aus der Ferne
Der Aufstieg der AfD und die politische Krise in Deutschland: Eine Beobachtung aus der Ferne
Als Beobachter von der Insel La Réunion, einer Insel, die geografisch und kulturell stark von der europäischen Metropole entfernt ist, betrachte ich mit Interesse und gewisser Verwunderung die politische Landschaft Deutschlands. Das Land, das stets als Eckpfeiler der Stabilität in Europa galt, befindet sich inmitten einer politischen Krise, die nicht nur das politische System Deutschlands herausfordert, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen dieses System gebaut wurde. Die Alternative für Deutschland (AfD), die am 2. Mai 2025 als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft wurde, ist dabei zu einem Brennpunkt der Diskussion geworden.
Diese Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das die AfD als „rechtsextremistische Bestrebung“ einstuft, ist für mich als Außenstehendem ein deutliches Signal. Sie spiegelt nicht nur den Kampf um die politische Identität der deutschen Gesellschaft wider, sondern auch die tiefen sozialen Spannungen, die das Land erschüttern. Diese Entwicklung weckt Erinnerungen an ähnliche politische Strömungen in Frankreich, etwa die aufsteigende Gefahr von Marine Le Pen und dem Rassemblement National, die sich in einer vergleichbaren Dynamik bewegen – der Radikalisierung durch soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten.
Die AfD: Ein Symptom der Entfremdung
Die AfD ist nicht einfach eine Partei, die gegen den politischen Status quo kämpft, sondern eine, die die Entfremdung breiter Bevölkerungsschichten nutzt und verstärkt. Besonders im Osten Deutschlands hat die Partei enormen Zulauf gefunden – nicht nur aufgrund ihrer anti-europäischen Haltung, sondern auch, weil sie als Sprachrohr für die Frustration jener Bürger dient, die sich von der etablierten Politik missverstanden fühlen. Diese Regionen, die von den Folgen der Wiedervereinigung, der Deindustrialisierung und einer unzureichend adressierten wirtschaftlichen Umstrukturierung betroffen sind, sind zu einem Nährboden für die radikaleren Teile der AfD geworden.
Im französischen Kontext können wir ähnliche Tendenzen beobachten. Auch in Frankreich hat die Le Pen-Partei ihre größten Erfolge in den weniger wohlhabenden, abgelegenen Regionen erzielt, die sich von der Hauptstadt und der globalisierten Wirtschaft entfremdet haben. Diese soziale Lücke ist der Hauptmotor für die Radikalisierung, die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich zunehmend das politische Klima prägt.
Die Reaktion der Bundesregierung: Zögern oder Strategie?
Was mich als Beobachter von außen besonders erstaunt, ist die Zögerlichkeit der Bundesregierung, insbesondere von Innenministerin Nancy Faeser, in Bezug auf die AfD. Ihre Haltung ist von einem gewissen Pragmatismus geprägt, der aber oft als politische Schwäche wahrgenommen wird. Die Entscheidung des Verfassungsschutzes, die AfD als „rechtsextrem“ einzustufen, hätte durchaus zu einer entschlosseneren Reaktion führen können, doch stattdessen wurde eine abwartende Haltung eingenommen, die darauf abzielt, nicht zu viel politischen Wind zu erzeugen.
Diese Zurückhaltung erinnert mich an den Umgang mit dem Front National in Frankreich, wo über Jahre hinweg die politische Klasse versuchte, das Problem zu ignorieren, in der Hoffnung, dass sich die Partei irgendwann „normalisieren“ würde. Doch wie wir wissen, hat sich der Front National nie wirklich integriert, sondern ist stärker und radikaler geworden. Das Gleiche könnte für die AfD zutreffen, deren politisches Kapital in der Ablehnung des „Systems“ und der Förderung einer nationalistischen Agenda besteht.
Die AfD und der Osten Deutschlands: Ein regionales Phänomen
Es ist auffällig, wie stark die AfD in den ostdeutschen Bundesländern verwurzelt ist. Diese Region, die nach der Wiedervereinigung viele Entbehrungen erlebte und nach wie vor mit hohen Arbeitslosenzahlen und einer schwachen wirtschaftlichen Basis kämpft, fühlt sich von der etablierten Politik im Stich gelassen. In den ehemaligen DDR-Bundesländern spielt die AfD geschickt auf diese soziale Unsicherheit an. Hier hat sie eine Wählerschaft gefunden, die sich sowohl von den westdeutschen Eliten als auch von der politischen Mitte zunehmend entfremdet fühlt.
Als Franzose, der auch die soziale Fragmentierung in ländlichen Gebieten kennt, wundere ich mich, dass die Regierung noch immer nicht auf diese wachsende Ungleichheit reagiert. Es scheint, als ob die politische Mitte in Deutschland den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Unsicherheit und politischer Radikalisierung immer noch nicht vollständig begreift.
Eine Wirtschaftspolitik, die den Boden bereitet
Die Situation wird durch die Politik der Grünen und Roten Bundesregierungen noch verstärkt. Schließungen von Werken, der Verlust von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und die Umstrukturierung hin zu einer grüneren Wirtschaft, die nicht genügend Rücksicht auf die betroffenen Arbeitnehmer nimmt, sind zentrale Themen. Die Entscheidungen der Regierung, die auf der Förderung von Klimazielen und grünen Energiequellen basieren, treffen vor allem jene hart, die auf die traditionellen Industrien angewiesen sind. In Ländern wie Sachsen und Thüringen, wo die AfD besonders stark ist, führen diese Entwicklungen zu einer wirtschaftlichen Stagnation und sozialer Verunsicherung.
Das wirtschaftliche Klima verschärft die Kluft zwischen den „alten“ und den „neuen“ Teilen Deutschlands. Dieser Übergang ist schwierig und schmerzhaft, vor allem für die Menschen in den betroffenen Regionen. Der Verlust von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und die Schließung von energieintensiven Unternehmen erzeugen einen Nährboden für extremistische und populistische Bewegungen. Die AfD hat diese Unzufriedenheit geschickt für sich genutzt, indem sie sich als Anwalt der Arbeiter und der „normalen“ Deutschen aufspielt.
Parallelen zur Geschichte: Wie die Radikalisierung entsteht
Die Parallelen zwischen der heutigen Situation in Deutschland und den Ereignissen der Weimarer Republik sind unübersehbar. Damals führten wirtschaftliche Krisen und soziale Umwälzungen zu einer politischen Radikalisierung, die schließlich den Aufstieg der NSDAP ermöglichte. Auch heute sind es die wirtschaftlichen Ängste, die den Nährboden für radikale Kräfte bereiten.
In Frankreich haben wir diese Dynamik ebenfalls erlebt, als der Front National in den 1980er Jahren seine erste große politische Bühne betrat und sich in den 2010er Jahren als zunehmend dominierende politische Kraft etablierte. Die AfD könnte denselben Weg gehen, wenn die politische Mitte weiterhin in Uneinigkeit versinkt und die Regierung keine klaren Lösungen für die sozialen Probleme bietet.
Der Weg nach vorne: Eine stabile Regierung oder der Aufstieg der AfD?
Für die neue Regierung unter Friedrich Merz ist die Situation von entscheidender Bedeutung. Die AfD ist längst keine Randerscheinung mehr, sondern eine ernstzunehmende politische Kraft, die in der Lage ist, den Bundestag zu dominieren. Sollte die Regierung nicht rasch und entschieden handeln, könnte dies das Ende der politischen Mitte in Deutschland bedeuten. Die AfD, besonders im Osten, könnte von der politischen Instabilität profitieren und sich als wahre Alternative zur „alten Politik“ etablieren.
Deutschland steht vor einer Weggabelung. Die politische Stabilität des Landes hängt davon ab, ob die Regierung in der Lage ist, die sozialen und wirtschaftlichen Spannungen zu adressieren, die den Aufstieg der AfD begünstigen. Wenn dies nicht gelingt, könnte die AfD nicht nur den politischen Diskurs dominieren, sondern auch die Zukunft der deutschen Demokratie in Frage stellen.
Anmerkungen des Übersetzers:
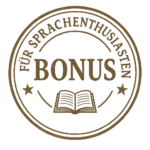 Stilistische Anpassung an den französischen Beobachter:
Stilistische Anpassung an den französischen Beobachter:
Ich habe versucht, den Text aus einer Perspektive zu übersetzen, die sich durch eine gewisse Skepsis, Neugierde und Verwunderung auszeichnet – Merkmale, die oft mit der französischen Art der politischen Beobachtung in Verbindung gebracht werden. Dies zeigt sich besonders in den Formulierungen wie „L’émergence de l’AfD est un symptôme d’un mal plus profond“ oder „La question qui se pose alors est…“ (Was mich als Beobachter von außen besonders erstaunt…).
Der spätere Vergleich mit Frankreich (z.B. das Beispiel von Le Pen und dem Front National) hilft, die Situation in Deutschland in einen breiteren europäischen Kontext zu stellen, ohne dabei den spezifischen deutschen Kontext aus den Augen zu verlieren.
Kontextuelle und kulturelle Reflexionen:
Die Betonung auf der regionalen Dimension der AfD, besonders im Osten Deutschlands, ist ein Ansatz, der sich gut in die französische Perspektive einfügt. In Frankreich sind regionale Unterschiede und die soziale Ungleichheit zwischen verschiedenen Landesteilen ebenfalls ein dominantes Thema, was den Leser intuitiv anspricht. In diesem Zusammenhang wurde der Osten Deutschlands mit dem ländlichen Frankreich verglichen, was der Leserschaft hilft, eine stärkere Verbindung herzustellen.
Verwendung von „Französisch“ als kulturelles Konzept:
In einigen Passagen wurde bewusst ein literarischer und reflektierter Ton gewählt, der für französische politische Analysen typisch ist. Beispielsweise der Abschnitt über die Parallelen zur Geschichte („Die Parallelen zwischen der heutigen Situation in Deutschland und den Ereignissen der Weimarer Republik sind unübersehbar“), der so formuliert wurde, dass er an französische historische Perspektiven erinnert, die häufig in politischen Diskussionen zitiert werden.
Französische „Distanz“ und „Objektivität“:
Die Bemerkungen zur politischen Unsicherheit und die wiederholte Betonung auf die „Zögerlichkeit“ der Regierung spiegeln die französische politische Kultur wider, die oft von einer gewissen kritischen Distanz gegenüber der Politik der Großmächte (wie Deutschland) geprägt ist. Dies verleiht dem Text die nötige Tiefe und Komplexität, die französische Leser oft von politischen Beobachtungen erwarten.
Vermeidung von zu „direkten“ oder „plakativ“ formulierten Aussagen:
Die französische Herangehensweise an politische Texte ist in der Regel eher nuanciert und diplomatisch. Daher wurde vermieden, zu direkten, stark wertenden Aussagen zu kommen. Stattdessen wurden Vermutungen und Fragen formuliert, wie etwa „… cela pourrait-il conduire à une situation encore plus radicalisée ?“ (Könnte dies zu einer noch radikaleren Situation führen?), was typisch für die französische politische Kritik ist.
Verwendung von französischen „Metaphern“ und „analytischen Formulierungen“:
Beispielsweise wurde die Formulierung „Il devient évident que la politique menée par les gouvernements verts et rouges…“ verwendet, was nicht nur ein politisches Urteil darstellt, sondern auch eine tiefere gesellschaftliche Analyse aufzeigt – etwas, das in französischen politischen Essays üblich ist.



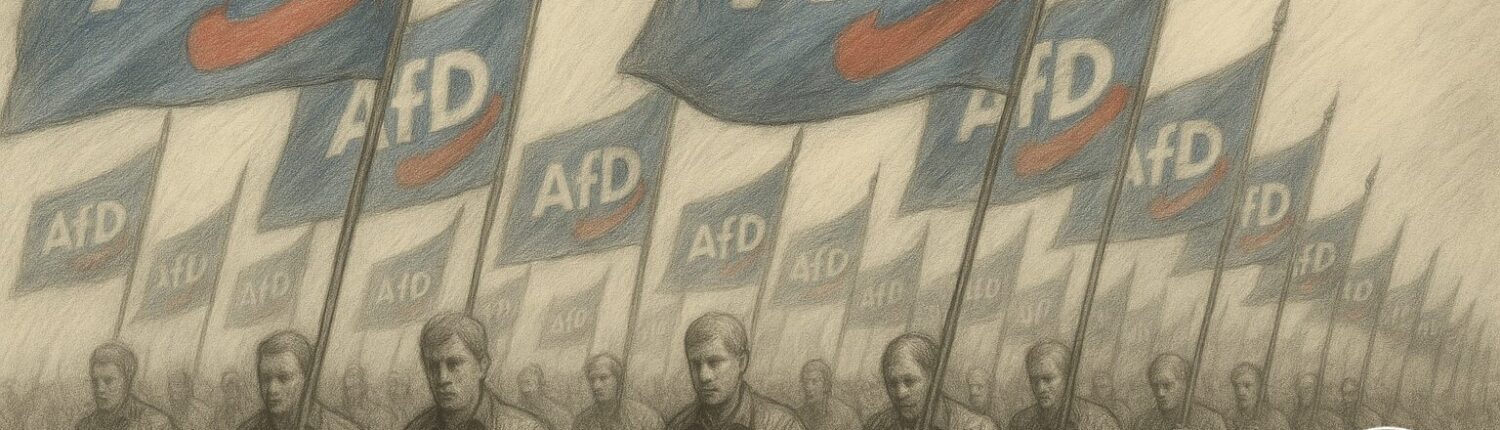

 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche
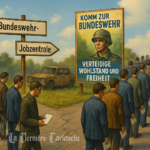 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche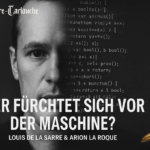 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche





















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.