![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Die Republik im Dauerprotest
Ein Land, das niemals ohne seine Straße regiert wird
Clemence Moreau | 15. September 2025
Paris, ein Septemberabend. Auf der Place de la République brennen wieder Mülltonnen, die Transparente schlagen wie zerrissene Fahnen im Wind, und das Echo der Slogans breitet sich zwischen den steinernen Fassaden aus wie ein alter Refrain. »Bloquons tout!« – »Alles blockieren!« Dieser Ruf klingt zugleich wie Zorn und wie Ritual. Um die französische Politik zu verstehen, muss man der Straße zuhören. Denn in Frankreich regiert man nicht nur in den Parlamentssälen, man regiert ebenso auf Asphalt und Pflaster. Die Republik lebt in ständigem Dialog mit ihrer eigenen Anfechtung. Hier ist der Protest nicht Ausnahme, sondern die zweite Grammatik der Demokratie.
Dieses intime Verhältnis zwischen Macht und Straße ist keine Erfindung der Gegenwart. Seine Wurzeln reichen zurück in den Sommer 1789, als die Bastille fiel und das Volk zum ersten Mal die Bühne der Geschichte betrat. Dort, wo andere Nationen sich an langsame Reformen gewöhnt haben, an institutionelle Kompromisse, lernte Frankreich von Beginn an, dass Legitimität aus dem sichtbaren, versammelten, verkörperten Volk erwächst. Die Revolution hinterließ nicht nur eine Verfassung, sie brannte ein Modell ein. Jede Generation, so glauben wir, hat das Recht und vielleicht sogar die Pflicht, die Autorität herauszufordern, sobald sie als erdrückend empfunden wird.¹
Seither hat das Gedächtnis unablässig dieselbe Dramaturgie wiederholt. Die Barrikaden von 1830 und 1848, die von aufgetürmten Pflastersteinen gesäumten Straßen, waren Erinnerungen daran, dass die bestehende Ordnung niemals vor einem Aufstand sicher ist. Victor Hugo hat diese Szenen in Les Misérables zum nationalen Mythos erhoben: die Barrikade als Ort der Brüderlichkeit und der Tragödie, als Raum von Opfer und Ruhm.² Die Kommune von 1871, im Blut von der eigenen französischen Armee niedergeschlagen, fügte eine noch tiefere Wunde hinzu: die Gewissheit, dass das Volk seinem eigenen Staat misstrauen muss, weil der Verrat aus dem Inneren kommen kann.³
Im 20. Jahrhundert erreichte diese Tradition eine neue Intensität: der Mai 1968. »Sous les pavés, la plage« – »Unter dem Pflasterstein, der Strand«. Der herausgerissene Stein war nicht mehr nur ein Wurfgeschoss, er wurde Metapher, Verheißung, Übergang in eine andere Welt.⁴ Die Straße war nicht länger allein ein Schlachtfeld, sie wurde zur Utopie. Seither umgeben sich alle sozialen Bewegungen mit Symbolen: der Pflasterstein, die Barrikade, der im Chor gerufene Slogan. In Frankreich ist Protest immer eine Inszenierung. Er ist nicht nur Verhandlungsinstrument, sondern Selbstbehauptung.
Darum üben selbst kleine Gewerkschaften, zahlenmäßig oft in der Minderheit, eine beträchtliche symbolische Macht aus. Ihre Stärke ist nicht statistisch, sie ist imaginär. Vor allem der Generalstreik ist weniger eine ökonomische Waffe als ein kollektives Ritual: eine Nation betrachtet sich selbst in ihren eigenen Blockaden. Pierre Rosanvallon hat einmal gesagt, die französische Demokratie sei »unvollendet, immer in Bewegung« – eine Demokratie der Anfechtung, in der Legitimität sich unaufhörlich im Widerspruch erneuert.⁵
Unsere Gegenwart hört nicht auf, dieses Szenario zu bestätigen. Die Gelbwesten, hervorgegangen aus den Kreisverkehren der Peripherie, haben der zentralen Macht eine rohe, unerwartete, unkontrollierbare Energie entgegengeschleudert.⁶ Sie erinnerten daran, dass die Kluft zwischen Paris und Provinz fortbesteht, dass das Volk sich nicht in die Grenzen der Metropolen sperren lässt. Die Rentenreformen haben das alte Feuer der Massenstreiks erneut entfacht. Und nun, in diesem Herbst 2025, erhebt sich das Banner »Bloquons tout«: offiziell gegen die Sparprogramme, im Grunde jedoch gegen die Anmaßung, von oben regiert zu werden.
Von außen betrachtet ließe sich darin eine chronische Ohnmacht erkennen. Gescheiterte Reformen, zerbrochene Haushalte, gestürzte Regierungen – die Republik scheint zum Selbstsabotage verdammt. Doch vielleicht muss man den Blick wenden. Vielleicht ist dieses Chaos in Wahrheit eine Ressource. Es hindert den zentralisierten Staat daran, in seiner eigenen Majestät zu versteinern. Es zwingt zur Auseinandersetzung, manchmal brutal, doch heilsam. Claude Lefort hat uns gelehrt, dass die Demokratie sich durch dieses »leere Zentrum« definiert, in dem Macht niemals ganz fixiert sein darf.⁷ Die französische Straße, mit ihren Zornesausbrüchen und Ritualen, ist dieses leere Zentrum in Fleisch und Blut: der Raum, in dem die Republik akzeptiert, sich selbst infrage zu stellen.
Natürlich hat diese Mechanik ihren Preis. Sie verschleißt die Regierenden, beunruhigt die Investoren, erschöpft die Bürger. Doch sie verleiht dem demokratischen Leben zugleich eine unverwechselbare Vitalität. Dort, wo andere Nationen im Konsens einschlafen, erwacht Frankreich im Konflikt. Dort, wo Deutschland sich in Kommissionen aufhält, um den Dissens zu glätten, entzündet Paris seine Plätze, um ihn ins grelle Licht zu stellen. Dieser Kontrast ist nicht nur politisch, er ist anthropologisch: Der französische Bürger beansprucht den Tumult als ein Recht, während sein deutscher Nachbar die Stabilität als eine Tugend sucht.
So beharrt die französische Republik, müde, aber lebendig, auf dieser seltsamen Logik. Jedes Gesetz, jede Reform, jede Vision muss die Prüfung der Straße bestehen, bevor sie Wirklichkeit wird. Es ist langwierig, chaotisch, manchmal vergeblich. Aber gerade dies verhindert, dass die Demokratie an Ermattung stirbt. Solange der Pflasterstein noch gelockert werden kann, bleibt auch die Republik in Bewegung. Ihre Kraft ist paradox: Sie liegt nicht im Frieden der Paläste, sondern im Aufruhr der Plätze. Und vielleicht ist es genau dort, in dieser unermüdlichen Anfechtung, wo ihre innerste Energie wohnt.
Fußnoten
1 François Furet, Penser la Révolution française, Paris 1978.
2 Victor Hugo, Les Misérables, Paris 1862.
3 Prosper-Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris 1876.
4 Kristin Ross, Mai ’68 und seine Nachleben, Frankfurt am Main 2002.
5 Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris 2000.
6 Pierre Blavier, Les Gilets jaunes à la lumière de l’histoire sociale, Paris 2020.
7 Claude Lefort, L’invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire, Paris 1981.





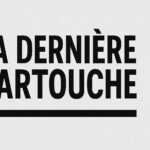 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.