![]()
Filter, Feeds, Faktenmacht
Wie Öffentlichkeit zur Strukturfrage wurde“
Sie sprechen nicht mehr von Kontrolle. Sie sprechen von Verantwortung. Sie sagen nicht mehr, was wahr ist. Sie sagen, was nicht gesagt werden darf. Wer heute die Wirklichkeit besitzt, braucht keine Zensur mehr – nur noch Zugang, Algorithmen und Vertrauen.
In der heutigen digitalen Ära ist die Macht der Medien zu einem zentralen Thema geworden, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Die Konzentration der Medien in den Händen weniger großer Konzerne wirft Fragen über Kontrolle, Verantwortung und die Zukunft des freien Diskurses auf. Diese Entwicklungen prägen nicht nur die Qualität der Information, sondern die gesellschaftliche Struktur selbst.
Medien sind nicht bloß Informationsvermittler, sie sind Realitätsarchitekten. Sie entscheiden, welche Themen sichtbar werden, welche Stimmen verstummen, was als relevant, harmlos oder gefährlich gilt. Ihre Rolle geht über das Kommentieren hinaus: Sie schreiben die Welt mit. Diese Macht ist strukturell. Sie braucht keine Kommandos, keine Verschwörung. Sie wirkt durch Besitz, durch Routinen, durch Stilllegungen.
Die ARD mit über 20 % Meinungsanteil ist keine Redaktion, sie ist ein System. Genauso Bertelsmann, Springer, Vivendi – Medienhäuser, deren ökonomische Durchdringung in Bildungswesen, Plattformökonomie und Politik reicht. Besitz bedeutet Deutung, und Deutung ist heute eine Ressource mit Verwertungslogik. Wo Eigentum auf Wahrheit trifft, entsteht ein Markt der Wirklichkeit.
Gleichzeitig verschiebt sich der Zensurbegriff. Die staatliche Kontrolle tritt als Wahrheitsgarantie auf – in Form von Gesetzen gegen “erkennbar falsche Tatsachenbehauptungen”. Die Intention: Schutz der Demokratie. Die Wirkung: Festschreibung von Deutungsautoritäten. Denn wer definiert, was “erkennbar falsch” ist? Die rechtliche Formulierung ist vage genug, um Spielräume zu schaffen, in denen Wahrheit politisch administriert wird.
Parallel dazu entfalten Plattformkonzerne eine lautlose Wirkmacht. Google, Meta, TikTok – sie kuratieren den Diskurs, nicht durch Inhalte, sondern durch Architektur. Algorithmen sind kein Werkzeug, sie sind Akteure. Sie entscheiden, was gesehen, geglaubt, gekauft wird. Sichtbarkeit wird zur politischen Kategorie. Wer nicht angezeigt wird, findet nicht statt. Diese Systeme schaffen keine Öffentlichkeit mehr, sondern selektive Realitäten.
Der Raum für Widerworte schrumpft. Nicht durch Verbot, sondern durch Relevanzentzug. Die Selbstzensur in Redaktionen und unter freien Journalisten ist eine Reaktion auf das Klima der Konformität. Die Mechanismen: Karriereanreize, Monetarisierungsdruck, Unsicherheit. Kritik, die nicht kompatibel ist mit den Annahmen der Plattform, der Redaktion oder des Markts, wird gefiltert – nicht immer bewusst, aber systematisch. Medienvielfalt bedeutet nicht Pluralität, sondern Formatdiversität bei inhaltlicher Homogenisierung.
Auch staatliche Kommunikationsstrategien verändern sich. Frankreichs Krisenvorsorgebroschüre wirkt wie ein logistisches Dokument, ist aber eine psychologische Intervention. Sie bereitet nicht nur auf den Ernstfall vor, sie legitimiert ihn vorab. Die Bevölkerung wird an das Szenario gewöhnt, damit es nicht mehr hinterfragt wird. Was wie Schutz aussieht, ist Disziplinierung.
Der Journalismus alter Prägung – langsam, prüfend, unbequem – ist zu einem Relikt geworden. Die Taktung der Plattformen, die Ökonomie der Aufmerksamkeit, die Algorithmen der Sichtbarkeit lassen für tiefgehende Recherche immer weniger Raum. Wer heute enthüllt, riskiert Unsichtbarkeit. Die Aufdeckung wird zur Marginalie, zur Fußnote im digitalen Strom.
Was fehlt, ist eine bewusste Re-Politisierung der Medienfrage. Es geht nicht nur um Inhalte, sondern um Infrastruktur, um Eigentum, um Architektur. Wer besitzt die Kanäle? Wer stellt die Regeln auf? Wer profitiert von der Struktur des Sagbaren? Diese Fragen lassen sich nicht durch Appelle an Ethik oder Pluralität beantworten, sondern nur durch eine systemische Analyse und eine politisch verankerte Medienkritik, die Eigentumsverhältnisse mitdenkt.
Medienmacht ist nie neutral. Sie wirkt durch, nicht neben der Gesellschaft. Wenn Öffentlichkeit zur Disziplinierungszone wird, wenn Vielfalt simuliert, aber nicht gelebt wird, dann ist der freie Diskurs nicht bedroht – er ist bereits ersetzt worden. Was bleibt, ist nicht Empörung, sondern Klarheit: darüber, wer die Wirklichkeit produziert. Und für wen.

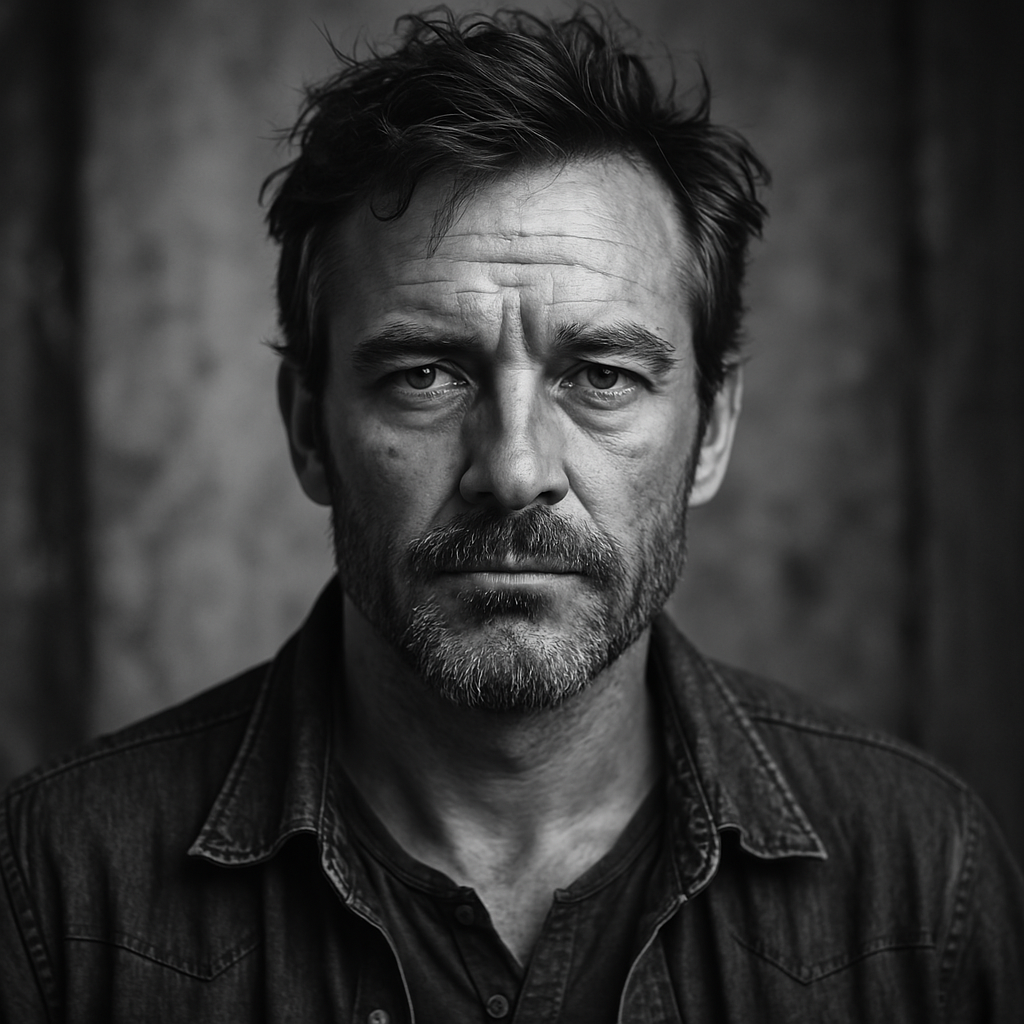



 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.