![]()
Gedenken ohne Geschichte –
Warum der Ausschluss Russlands vom 8. Mai ein Akt der historischen Selbstverleugnung ist
Wer am 8. Mai Gedenken politisch instrumentalisieren will, sollte mit der Geschichte vorsichtig umgehen. Der Beitrag „Man feiert nicht mit Mördern. Auch nicht am 8. Mai“ von Leander F. Badura behauptet, der Ausschluss Russlands von der Gedenkveranstaltung im Bundestag sei „logisch“ – weil Moskau gegen die Ukraine Krieg führt. Was moralisch plausibel klingt, ist historisch gefährlich. Denn wer Erinnerung von aktuellen Machtverhältnissen abhängig macht, der zerstört ihre Funktion: die Vermittlung zwischen gestern und morgen – nicht zwischen Lagern von heute.

Zur Quelle des Kommentars:
Dieser Artikel bezieht sich auf einen Beitrag, der am 20. April 2025 auf der Freitag erschienen ist:
„Man feiert nicht mit Mördern. Auch nicht am 8. Mai“ von Leander F. Badura
Der 8. Mai ist ein europäischer Tag. Kein russischer, kein deutscher, kein ukrainischer. Er ist ein Tag der Erinnerung an das Ende des Grauens, das Europa sich selbst zugefügt hat – und ein Tag der Verpflichtung, das Erbe jener zu wahren, die es unter unvorstellbaren Opfern beendeten. In Deutschland gedenkt man an diesem Tag seit Jahrzehnten auch der Rotarmisten, die bei der Befreiung Europas halfen – oft anonym, oft instrumentalisiert, aber nie vergessen. Doch in diesem Jahr, so wird verkündet, sollen weder Russland noch Belarus zu offiziellen Gedenkfeiern im Bundestag eingeladen werden.
Leander F. Badura, Theaterkritiker und gelegentlicher Kommentator des “Freitag”, nennt das in einem Kommentar vom 20. April 2025 nicht etwa eine Zäsur, sondern eine moralische Notwendigkeit. Seine Argumentation liest sich wie ein Paradebeispiel politischer Selbstgerechtigkeit, vermischt mit geschichtlicher Kurzsichtigkeit und einer erschreckenden Bereitschaft, Gedenken durch Gesinnung zu ersetzen. Man feiere nicht mit Mördern, heißt es dort. Auch nicht am 8. Mai.
Diese Behauptung hat eine gewisse Wucht. Aber sie ist historisch naiv, politisch dumm und moralisch verstiegen. Denn wer Russland heute aus der Erinnerungsgemeinschaft ausschließt, der tut genau das, was er Moskau selbst vorwirft: Er vereinnahmt Geschichte und zieht eine ideologische Linie durch das kollektive Gedächtnis. Dass Badura Russland vorhält, es spreche in seinen Gedenkritualen zu wenig über die Ukrainer in der Roten Armee, ist ironisch. Denn mit dem Ausschluss Russlands aus dem Gedenken exkommuniziert man gleich die ganze Sowjetunion mit – und damit auch all jene, die in ihren Uniformen gefallen sind. Ukrainer, Belarussen, Georgier, Armenier, Kasachen. Wer entscheidet, dass ihr Opfer heute nicht mehr zählt?
Badura glaubt, der Ausschluss sei ein Zeichen der Haltung. In Wahrheit ist es ein Zeichen für das Ende jener Form des Erinnerns, die über Tagespolitik steht. Er beklagt mit Pathos die Instrumentalisierung des Gedenkens durch den Kreml, während er selbst das Gedenken in ein Belohnungssystem verwandeln möchte: Wer sich heute richtig verhält, darf trauern. Wer nicht, wird ausgeladen.
Man fragt sich, ob Badura je ein sowjetisches Ehrenmal besucht hat, ob er je mit einem Enkel eines gefallenen Soldaten gesprochen hat, der keinen Grabstein, sondern nur das Datum 8. Mai kennt. Wahrscheinlich nicht. Dafür aber hat er in Berlin, Freiburg und Aix-en-Provence Literatur, Theorie und Lateinamerika studiert. Das soll ihm hier nicht zum Vorwurf werden – wohl aber, dass er sich anmaßt, aus dieser Biografie heraus darüber zu urteilen, wer zum Erinnern eingeladen werden darf.
Das eigentliche Problem ist tiefer: Wenn Deutschland seine historische Verantwortung ernst nimmt, muss es trennen können zwischen dem Staat Russland unter Putin und den Gefallenen der Roten Armee. Wenn Russland sich heute selbst aus der Weltgemeinschaft entfernt, so ist das tragisch. Aber es hebt nicht die Pflicht auf, den Toten gerecht zu werden. Das Gedenken am 8. Mai war nie ein diplomatischer Empfang. Es war ein stilles Bekenntnis zur Geschichte. Und wer es in einen Prüfstein aktueller Moral verwandelt, zerstört gerade das, was es zu schützen galt.
Die viel zitierte Frage, wen man denn einladen solle, ist längst beantwortet. Deutschland hat diplomatische Beziehungen zu Russland. Es gibt Botschafter, Attachés, kulturelle Vertretungen. Man kann sehr genau und sehr klug einladen. Und man kann gleichzeitig klarstellen: Dies ist ein Gedenken, kein Freibrief. Man kann Ehrung gewähren, ohne Politik zu segnen.
Aber das erfordert Haltung, nicht Haltungstheater. Es erfordert historische Reife, nicht Empörungsrhetorik. Und es erfordert einen Begriff von Gedenken, der über die eigene Blase hinausweist. Was Leander F. Badura hier betreibt, ist keine Erinnerungskultur. Es ist eine kulturpolitische Selbstbespiegelung. Und die ist, mit Verlaub, eines Gedenktags wie dem 8. Mai nicht würdig.
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!

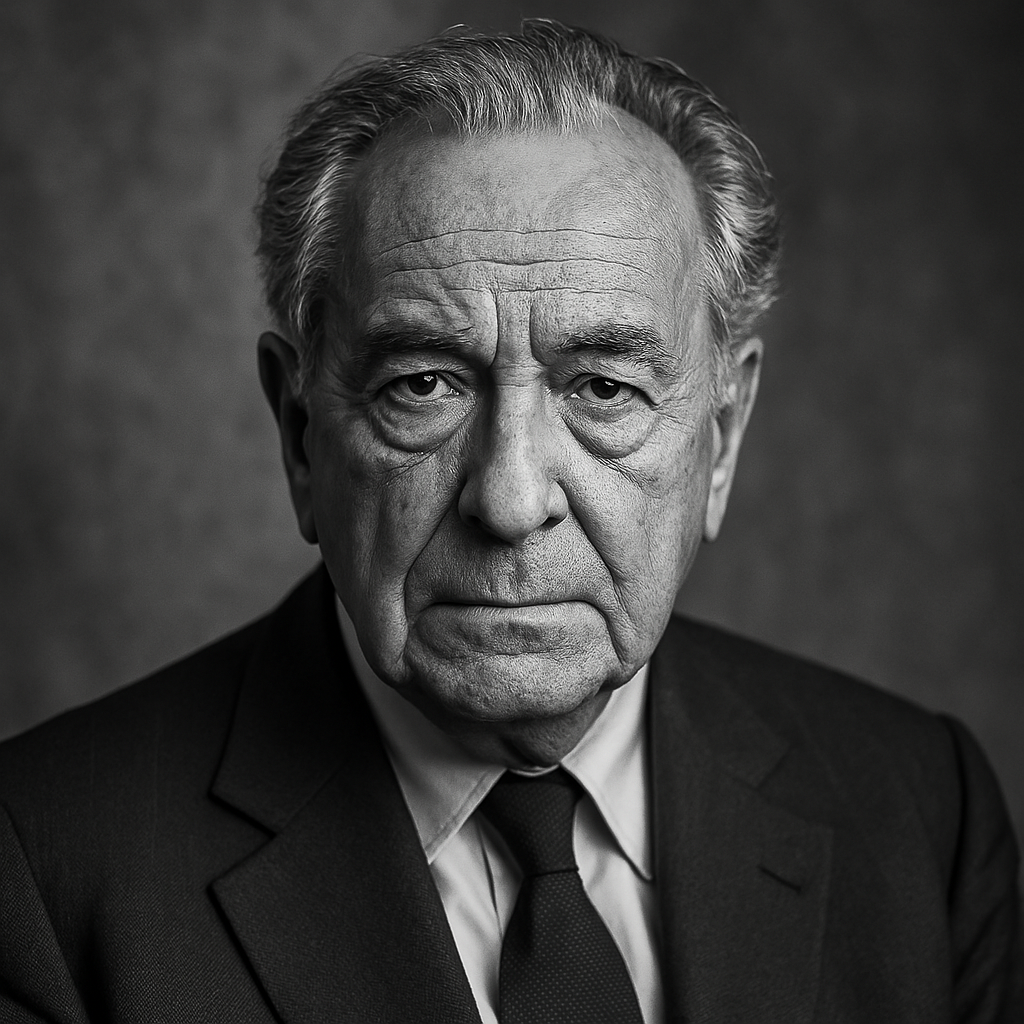



 Le JOUR POLITIQUE
Le JOUR POLITIQUE © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche





















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Ein wichtiger Beitrag. Man versucht, alles über einen Kamm zu scheren. Und das ist gefährlich.