![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Ein Wort, zwei Welten
Warum derselbe Satz in Deutschland heute gefördert, verfolgt und gefürchtet wird
Er wiederholte, ironisch, was die taz schon 1997 titelte: „Deutschland, erwache?“
Der eine wird gefördert, der andere durchsucht.
Der Fall erzählt mehr über den heutigen Umgang mit Sprache, Ironie und politischer Zugehörigkeit als über die Paragraphen, die ihn tragen.
Es beginnt mit einem Tweet, sechzehn Worte lang. „Gute Übersetzung von ‘woke’: Deutschland erwache!“ Der Satz stammt von Norbert Bolz, emeritierter Medienwissenschaftler, kein Aufrührer, sondern ein ironischer Beobachter. Er reagiert damit auf eine Überschrift der taz, die selbst – 1997 und später erneut – unter genau dieser Wendung publiziert hatte: „Deutschland, erwache?“ Ein ironischer Kommentar zur politischen Selbstzufriedenheit der Republik, damals, unbeanstandet, im linken Feuilleton als Satire gelesen. Achtundzwanzig Jahre später ist derselbe Ausdruck Anlass für ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Am 23. Oktober 2025 durchsuchte die Berliner Staatsanwaltschaft seine Wohnung, ließ Geräte sichern und berief sich auf § 86a StGB.
Was sich hier abspielt, ist kein Streit um Worte. Es ist die Verschiebung des juristischen Koordinatensystems. Die Phrase „Deutschland erwache!“ stammt ursprünglich aus dem Repertoire der SA. Doch ihr Gebrauch ist nicht per se verboten, sondern nur, wenn er in affirmativer oder identifikatorischer Absicht erfolgt. Bolz benutzte sie als Spiegel, nicht als Fahne. Der Unterschied ist so deutlich, dass er im deutschen Strafrecht eigentlich selbstverständlich sein sollte. Er bildet den Kern der sogenannten Kontextauslegung – jener minimalen Schutzlinie zwischen freiheitlicher und pädagogischer Republik. Natürlich ist die Abwägung zwischen Kunstfreiheit und dem Schutz vor totalitären Symbolen komplex; doch wer den Kontext ignoriert, kriminalisiert das Zitat. Wird diese Linie aufgegeben, verwandelt sich das Strafrecht in ein Instrument zur Prüfung politischer Position.
Doch der Fall Bolz ist kein Einzelfall. Er offenbart ein Muster: dieselben Worte können in einem Milieu als künstlerische Provokation gelten, in einem anderen als Verdachtsmoment. Während man also einen emeritierten Professor kriminalrechtlich prüft, weil er eine Ironie teilt, fördert dieselbe Bundesregierung ein Musikprojekt mit exakt demselben Titel: „Deutschland erwache!“ – gefördert 2025 unter Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Das Werk, so die offizielle Begründung, sei Kunst, förderungswürdig, Teil der kulturellen Auseinandersetzung mit Identität. Dieselben Worte, zwei völlig gegensätzliche Bewertungen. Der Staat, der hier als Kläger auftritt, ist zugleich der Mäzen. Er bestraft, was er subventioniert, und subventioniert, was er bestraft.
Das Problem liegt nicht in der Doppelmoral, sondern in der Struktur, die sie möglich macht. In Deutschland entscheidet nicht mehr die Handlung, sondern die politische Position. Die Strafbarkeit eines Wortes hängt davon ab, wer es ausspricht, nicht was es bedeutet. Im progressiven Kontext gilt es als ästhetische Provokation, im konservativen als latent faschistischer Reflex. Das Strafrecht wird zum Seismographen ideologischer Zugehörigkeit.
Man sollte sich daran erinnern, wozu § 86a StGB geschaffen wurde: um die Wiederbelebung totalitärer Zeichen zu verhindern, nicht um ironische Spiegelungen zu verfolgen. Dass ein Amtsgericht in Berlin auf dieser Grundlage eine Durchsuchung genehmigt, zeigt weniger juristische Strenge als kulturelle Nervosität. Der Staat verliert seine Gelassenheit, sobald die Ironie von der falschen Position kommt. Er verwechselt Kritik mit Kontamination.
Doch eine Demokratie, die Ironie nicht mehr aushält, ist eine, die ihren eigenen Ernst nicht mehr begreift. Wenn die gleichen Worte in einem Fall als Kunst gelten, im anderen als Kriminalfall, dann ist das kein Zufall, sondern ein Spiegel: ein Staat, der sein Verhältnis zur Sprache verloren hat. Der Fall Bolz ist daher weniger ein Skandal als ein Symptom. Er zeigt, dass in einem Land, das seine Vergangenheit zu Recht ernst nimmt, die Angst vor Missverständnissen inzwischen größer ist als das Vertrauen in die Urteilskraft der Bürger.
Freiheit besteht nicht darin, dass man sagen darf, was alle verstehen. Sie besteht darin, dass man auch sagen darf, was missverstanden werden könnte – und dass der Staat trotzdem ruhig bleibt.
„Er bestraft, was er subventioniert, und subventioniert, was er bestraft. Das ist keine Doppelmoral, sondern eine Sprachverwirrung im Herzen der Demokratie – und sie nährt den Verdacht, dass Recht nicht mehr blind, sondern parteiisch hört.“
Quellen
taz, 10. 05. 1997, Doris Akrap: „Deutschland, erwache?“
taz, 23. 10. 2025: „Durchsuchung wegen Tweet“.
FAZ, 23. 10. 2025: „Hausdurchsuchung bei Norbert Bolz in Berlin“.
LTO, 24. 10. 2025: „Strafrechtlicher Tabubruch oder Überreaktion?“
Junge Freiheit, 24. 10. 2025: „Ein Wortlaut, zwei Maßstäbe: Roth fördert, wofür Bolz ins Visier gerät“.
Im Gespräch: Pierre Marchand über den Fall Bolz
Théodore Maillan, vom französischen Politikmagazin “LE JOUR POLITIQUE“spricht mit Pierre Marchand über Sprache, Recht und die Angst vor Ironie. Anlass ist der Tweet von Norbert Bolz und die Berliner Durchsuchung. Das Gespräch folgt der Argumentationslinie des Essays und übersetzt sie in präzise Fragen und klare Antworten.

Le Jour Politique ist ein politisch-analytische Magazin von La Dernière Cartouche. Es erscheint digital und in Dossiers, versteht sich als Raum für klare Sprache und intellektuelle Redlichkeit. Hier schreiben Journalisten und Denker jenseits der Parteigrenzen über Macht, Medien, Institutionen und Ideologien – mit dem Anspruch, politische Wirklichkeit zu erklären, nicht zu beschönigen. Stilistisch kühl, faktisch präzise, frei von Parolen. Jede Ausgabe verbindet juristische Schärfe mit kulturhistorischer Tiefe und folgt dem Grundsatz: Verstehen kommt vor Bewerten.
Le JOUR POLITIQUE: Herr Marchand, beginnen wir ganz nüchtern. Ein Tweet mit sechzehn Wörtern. Eine Hausdurchsuchung in Berlin. Was sehen Sie, wenn Sie nur das Verfahren betrachten und alle Debatten ausblenden?
P. Marchand: Ich sehe eine Justiz, die ihre Gelassenheit verloren hat. Nicht im Sinne einer Feindseligkeit gegen die Freiheit, sondern in einer leiseren Bewegung. Sie versucht, Demokratie nicht nur zu schützen, sondern zu erziehen. Wo Recht erzieht, wird es parteiisch. Es untersucht dann weniger die Tat als die Haltung.
Le JOUR POLITIQUE: er Satz Deutschland erwache hat eine belastete Geschichte. Die Berliner Behörde verweist auf Paragraf 86a. Ist das nicht naheliegend?
P. Marchand: Die Herkunft des Satzes ist unbestreitbar. Aber das deutsche Strafrecht kennt die Kontextauslegung. Entscheidend ist die Intention. Affirmation ist strafbar. Spiegelung nicht. Bolz hat den Satz nicht als Losung gebraucht, sondern als Spiegel für eine Gegenwart, die sich selbst moralisch auflädt. Wer den Kontext ignoriert, kriminalisiert das Zitat. Genau dort verläuft die minimale Schutzlinie zwischen freier und pädagogischer Republik.
Le JOUR POLITIQUE: In Ihrem Essay sagen Sie, der Staat bestrafe, was er subventioniere, und subventioniere, was er bestrafe. Wollen Sie damit Willkür unterstellen?
P. Marchand: Ich unterstelle einen Verlust an semantischer Ehrlichkeit. Dass ein Bundesprojekt mit identischer Titelformulierung unter Kulturförderung läuft, während derselbe Wortlaut in anderem Milieu strafrechtlich relevant wird, zeigt keine Laune der Behörden, sondern eine Strukturlücke. Die Bewertung hängt nicht mehr am Gebrauch, sondern am Sprecher. Das ist der Kipppunkt. Das Recht wird zum Seismographen ideologischer Zugehörigkeit.
Le JOUR POLITIQUE: Kritiker würden einwenden, dass Kunstfreiheit einen Sonderstatus besitzt. Ist das nicht ein stichhaltiger Unterschied?
P. Marchand: Kunstfreiheit ist zentral. Sie hebt aber nicht die Pflicht zur Kontextprüfung auf, sie bekräftigt sie. Wenn ein Satz im Kunstkontext als Auseinandersetzung gelesen werden kann, muss derselbe Maßstab auch im diskursiven Kontext gelten, sobald Ironie und Zitatgebrauch erkennbar sind. Sonst verschiebt sich das Kriterium heimlich vom Was zum Wer.
Le JOUR POLITIQUE: Sie sprechen von einer weichen Tyrannei des Guten. Ist das nicht überzogen?
P. Marchand: Ich meine das wörtlich weich. Keine Stiefel. Keine Gewalt. Eine Fürsorgesprache, die sich von Schutz und Respekt her legitimiert und darüber zu Grenzziehungen in der Sprache gelangt. Wer widerspricht, steht scheinbar gegen das Gute. Diese Moralgrammatik lässt Recht nervös werden. Nichts Spektakuläres. Bürokratisch. Aber folgenschwer.
Le JOUR POLITIQUE: Ihr Bezug auf Orwell liegt nahe. Leben wir in einer orwellschen Situation?
P. Marchand: Wir leben nicht in Orwell. Aber wir benutzen seine Grammatik. Nicht Überwachung ist das Zentrum, sondern die Politisierung von Bedeutung. Wenn derselbe Ausdruck je nach Sprecher gegenteilig bewertet wird, entsteht Neusprech ohne neue Wörter. Das ist die semantische Verschiebung, die er beschrieben hat.
Le JOUR POLITIQUE: Ist das dann Gesinnungsjustiz?
P. Marchand: Sobald Herkunft und Zugehörigkeit des Sprechers die rechtliche Bewertung überlagern, ja. Gesinnungsjustiz muss nicht laut auftreten. Sie ist die elegante Form des Vorurteils. Das erschwert ihre Kritik, weil sie im Namen des Schutzes operiert.
Le JOUR POLITIQUE: Was sagt dieser Fall über Deutschland im Jahr 2025 aus?
P. Marchand: Dass die Angst vor Missverständnissen größer geworden ist als das Vertrauen in die Urteilskraft der Bürger. Eine Demokratie, die Ironie nicht aushält, unterschätzt ihr Publikum. Und sie überlastet das Strafrecht mit Aufgaben, die eigentlich in Öffentlichkeit, Kritik und Kulturdebatte gehören.
P. Marchand: Worin liegt der Kernfehler der Berliner Entscheidung aus Ihrer Sicht?
Antwort: In der Verwechslung von Zitatgebrauch und Identifikation. Das Strafrecht soll die Reaktivierung totalitärer Zeichen verhindern. Es soll nicht Spiegelungen bestrafen. Wer die Unterscheidung aufgibt, rutscht vom Schutz der Ordnung in die Pädagogik der Sprache.
Le JOUR POLITIQUE: Manche würden sagen, es handelt sich nur um eine Durchsuchung. Die Justiz prüft, sie verurteilt noch nicht. Ist die Aufregung nicht zu groß?
P. Marchand: Die Frage ist berechtigt. Aber schon die Schwelle der Zwangsmaßnahme markiert eine staatliche Deutungshoheit über Ironie. Das ist der symbolische Schaden. Er zeigt, wie tief die Nervosität reicht. Man muss das nicht dramatisieren. Man sollte es genau benennen.
Le JOUR POLITIQUE: Ein französischer Leser wird fragen, ob Deutschland hier besonders empfindlich ist, weil es seine Vergangenheit ernst nimmt.
P. Marchand: Das Ernstnehmen der Vergangenheit ist eine Stärke. Die Übertragung in ein starres Sprachhygienerecht ist es nicht. Erinnerungskultur verlangt Urteilskraft, nicht Automatismen. Der reflektierte Umgang mit Symbolen gelingt, wenn man Bürgern die Unterscheidung zutraut. Sonst lernt man nur, heikle Wörter zu meiden. Man lernt nicht, sie zu verstehen.
Le JOUR POLITIQUE: In Frankreich wird oft mit grober Satire gearbeitet. Sehen Sie einen kulturellen Unterschied?
P. Marchand: Ja. Französische Satire erlaubt stärkere Reibung, riskiert aber Zynismus. Deutsche Öffentlichkeit schützt Empfindlichkeiten stärker, riskiert aber pädagogische Überkorrektur. Beides hat Preis und Nutzen. Der Fall Bolz zeigt, wie schnell Schutz in Kontrolle umkippen kann, wenn man dem Publikum Misstrauen entgegenbringt.
Le JOUR POLITIQUE: Kommen wir zur Politik. Sie sagen, die Impulse für diese Sprachverwaltung kämen heute eher aus dem linken Spektrum. Warum ist das bemerkenswert?
P. Marchand: Weil gerade dieses Spektrum historisch die Freiheitsrechte gegen staatliche Moralisierung verteidigt hat. Wenn es jetzt in kulturpolitischen Fragen zur Verwahrung der Sprache tendiert, entsteht ein Bruch im eigenen Selbstverständnis. Das ist nicht Heuchelei. Es ist eine Verschiebung der Prioritäten. Schutz der verletzlichen Gruppen wird zur obersten Maxime. Aber wenn Schutz zur Sprachverwaltung wird, verliert man Terrain an jene, die einfach nur Freiheit sagen, auch wenn sie damit anderes meinen.

Im Gespräch: Pierre Marchand über den Fall Bolz
Le JOUR POLITIQUE: Was wäre die einfache rechtsstaatliche Korrektur, ohne großes Pathos?
P. Marchand: Drei Sätze. Erstens. Kontext vor Katalog. Zweitens. Intention vor Anschein. Drittens. Gelassenheit vor Zwang. Das reicht, um 86a nicht zu entwerten und Ironie nicht zu kriminalisieren.
Le JOUR POLITIQUE: Und wenn jemand den Ausdruck tatsächlich affirmativ nutzt?
P. Marchand: Dann greift das Strafrecht zurecht. Die Unterscheidung ist kein Schlupfloch, sondern ihr Sinn. Wer bekennt, bekennt. Wer spiegelt, spiegelt. Ein Staat, der das nicht trennen kann, verliert seine begriffliche Präzision.
Le JOUR POLITIQUE: Ihr Essay endet mit einem Satz über Freiheit und Missverständnis. Können Sie das als Schlusswort in einem Satz sagen?
P. Marchand: Freiheit heißt, dass der Staat ruhig bleibt, auch wenn er missverstanden werden könnte.
Le JOUR POLITIQUE: Vielen Dank für das Gespräch.
P. Marchand: Ich danke Ihnen.
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!



 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche
 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche







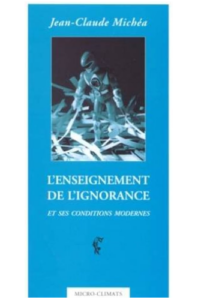
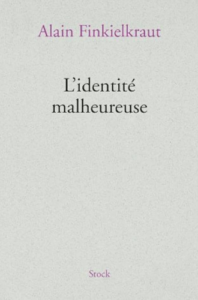
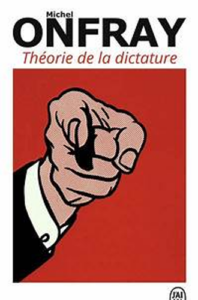












 © La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)
© La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.) © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 
Iss doch wie mit den Abschiebungen. Stellen Sie sich vor, die AfD hätte gesagt, was der Kanzler gesagt hat: https://www.spiegel.de/international/germany/interview-with-german-chancellor-olaf-scholz-we-have-to-deport-people-more-often-and-faster-a-790a033c-a658-4be5-8611-285086d39d38
Iss doch wie mit den Kreuzen. Stellen Sie sich vor, JC Hopkins hätte sowas auf seinem Buchcover verwendet: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/hakenkreuze-auf-spiegel-und-stern-rechtsruck-auf-li.2219681
Ein unglaublicher Vorgang. Ein guter Text. Abrüstung stünde uns gut an. Die Kontextauslegung war mir noch gar nicht bekannt. Ein Seiltanz. La Dernière Cartouche bildet!