![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Zweisprachig in einer Sprache – Die doppelte Buchführung des Französischen
Die doppelte Buchführung des Französischen
Chanmé“ ist verlan (Umkehrsprache) von méchant („gemein, böse“) – bekommt aber im Jugendjargon die positive Umdeutung: cool, beeindruckend, geil. Also:„Yo, c’est chanmé!“ ≈ „Ey, das ist richtig geil!“
Zweisprachig in einer Sprache – Die doppelte Buchführung des Französischen
Ein Versuch über Klang, Klasse und das Recht auf Zugehörigkeit
Französisch, so wird es seit Jahrhunderten verkündet, ist keine Sprache wie jede andere. Es sei die Sprache der Liebe, der Diplomatie, der Philosophie. Eine Sprache, die klingt, als hätte sie sich selbst erfunden – ziseliert wie ein Jugendstilornament, klar wie ein Pastisglas im Mittagslicht von Aix. Wer sie spricht, so suggeriert man, gehört zu einer höheren Liga des Ausdrucks: kultiviert, weltgewandt, ein wenig melancholisch. Französisch – das ist eine Verheißung. Und zugleich eine Lüge.
Denn wer einmal versucht hat, diese Sprache zu leben – nicht zu lernen, nicht zu rezitieren, sondern mit ihr den Einkauf zu erledigen, ein Missverständnis zu klären oder ein Taxi in der Banlieue zu rufen –, der weiß: Französisch gibt es nicht. Es gibt zwei. Mindestens.
Man betritt die Bühne mit „travail“, „argent“ und „fatigué“ im Gepäck – Wörter, sauber gebügelt, wie aus dem Lehrbuch gefallen. Doch kaum beginnt das Gespräch, verwandeln sich die Rollen. „Travail“ wird zu „boulot“, „argent“ zu „blé“, und „fatigué“ ist nicht mal der Schatten von dem, was „crevé“ meint: das platte Gefühl, dass nicht nur der Körper, sondern auch das letzte Stück Hoffnung auf Feierabend erschöpft ist. Man merkt: Diese Sprache hat zwei Gesichter – und nur eines davon wird in Klassenzimmern gezeigt.
Die Kunst der Tarnung
Das „richtige“ Französisch – das der Theaterstücke, der Reden, der Diplomaten – ist eine Maske. Es will bewahren, was längst bröckelt: ein Ideal von Eleganz, das sich nie durchgesetzt hat, außer in elitären Salons. Die andere Sprache, die sich über die Jahrzehnte in Raptexten, Schulhöfen, Wartezimmern und TikTok-Kommentaren ausgebreitet hat, kennt keine Masken. Sie ist direkt, flüchtig, oft derb – aber immer echt. Sie lebt vom Kontext, vom Tonfall, vom Blick dazu. Wer nur das Vokabular kennt, versteht nichts.
Ein Schüler sagt: „J’suis à la bourre.“ Ein Lehrer korrigiert: „En retard, bitte.“ Und beide wissen: Nur einer von ihnen lebt im Frankreich von heute.
Die sozialen Trennlinien verlaufen nicht mehr nur zwischen reich und arm, Stadt und Land, Zentrum und Peripherie. Sie verlaufen durch die Sprache. Ein „flic“ ist kein „policier“. Der eine riecht nach Straßenecke, der andere nach Ministerium. Ein „reuf“ ist kein „frère“. Es ist der Bruder aus der eigenen Realität, nicht der aus dem Lexikon. Wer „chanmé“ sagt, sagt mehr als „génial“ – er sagt: Ich bin drin, ich weiß, wie man sich bewegt.
Sprache als Grenzübergang
Man könnte das alles als linguistische Kuriosität abtun, eine Art französisches Idiomen-Kaleidoskop. Doch es geht um mehr. Sprache ist ein Machtmittel. Sie entscheidet, wer gehört wird – und wer nur geduldet. Sie entscheidet, wer einen Platz am Tisch bekommt – und wer draußen bleibt, mit seinem „fric“ statt „argent“, seiner „galère“ statt „situation difficile“. Und sie entscheidet auch, wer mit welcher Stimme sprechen darf. Der Schüler aus Seine-Saint-Denis, der seinen Text im Präsens deklamiert wie ein Dichter, wird korrigiert. Der Austauschschüler, der höflich „puis-je?“ fragt, wird belächelt. Es ist ein Tanz auf Messers Schneide – mit jeder Silbe droht der soziale Fehltritt.
In Frankreich spricht man nicht einfach Französisch. Man wählt eine Sprache – und wird gewählt.
Postkartenlügen und Sprachsplitter
Der Mythos des harmonischen, wohlklingenden Französisch lebt in Postkarten weiter. Auf ihnen steht „La vie est belle“, während der Absender auf seinem Handy „gros daron“ tippt. Zwei Welten, ein Land. Zwei Codes, eine Währung: soziale Zugehörigkeit. Wer den Code nicht kennt, bleibt draußen. Die Sprache schützt sich selbst, indem sie sich teilt. Und sie straft jene, die das Falsche sagen, im falschen Moment, mit dem falschen Akzent.
Das ist kein Zufall. Es ist System. Die Académie française kämpft um jedes Wort wie um eine Bastion – während draußen längst andere Regeln gelten. Die Sprachlandschaft Frankreichs ist kein gepflegter Garten. Sie ist ein zerklüftetes Terrain, durchzogen von Bruchlinien, voller Stolpersteine und geheimer Pfade.
Am Ende bleibt das Baguette
Und irgendwo dazwischen steht er: der Fremde. Der Austauschschüler, die Migrantin, der frankophile Tourist mit dem Cours intensif. Sie alle haben gelernt, dass „merci beaucoup“ höflich ist, „baguette“ ein Brot und „amour“ ein Gefühl. Und sie alle haben irgendwann gemerkt, dass ein „wesh“ mehr Türen öffnet als ein fehlerfreies „subjonctif passé“.
Die Sprache des Französischen ist kein Ort. Sie ist ein Feld. Ein Ort der Macht, der Ausgrenzung, der Verwandlung. Sie ist eine Sprache, die sich selbst bekämpft – und dabei schöner klingt als jede andere.
Französisch? Man lernt es nicht. Man verliert sich darin. Zweimal. Mindestens.
🗣 Sprachlexikon zum Text – Was hier wirklich gesagt wird
Verlan ist eine französische Sprechweise, bei der Silben von Wörtern umgedreht werden – ursprünglich aus der Banlieue stammend, dient sie als Code für Zugehörigkeit, Widerstand und informelle Kommunikation.
| Begriff | Standardform / Herkunft | Bedeutung / Gebrauch |
|---|---|---|
| boulot | travail | Alltagssprachlich für Arbeit; informeller, handfester |
| blé | – (wörtlich: Weizen) | Geld (umgangssprachlich, bildhaft) |
| fric | aus fricot (17. Jh., Soldatenjargon für Essen/Geld) | Geld, salopp oder leicht abwertend |
| pognon | vermutlich aus poigne (Faust, Handvoll) oder pognée (Handgriff) | Geld mit Konnotation von Status / Korruption |
| thunes | aus tune, Jargon für „Geld“ (ursprünglich: Münzprägung in Tunis) | Viel Geld, salopp, im Sinne von „Kohle“ |
| galère | aus dem Französischen für Galeerenschiff (Zwangsarbeit, Leid) | Stress, Misere, schwierige Lebenslage |
| crevé | fatigué | Fix und fertig, körperlich und psychisch erschöpft |
| à la bourre | en retard | Zu spät dran, Hektik |
| J’suis à la bourre | Je suis en retard | Ich bin zu spät (umgangssprachlich verkürzt) |
| flic | policier | Umgangssprachlich für Polizist, distanziert oder abwertend |
| keuf | flic (verlan) | Noch salopper für Polizist, oft im Banlieue-Slang |
| chanmé | méchant (verlan) | Jugendsprache für „krass“, „geil“, „heftig“ (positiv) |
| crevé | von crever (platzen, krepieren) | komplett fertig, körperlich-moralisch erschöpft; deutlich drastischer als fatigué, oft in Arbeitermilieu, Jugend- oder Banlieue-Kontext gebraucht |
| reuf | frère (verlan) | Bruder, Kumpel, Bruderfigur |
| meuf | femme (verlan) | Frau, Mädchen – kontextabhängig auch sexistisch |
| ouf | fou (verlan) | Verrückt, irre – oft bewundernd |
| wesh | – (arabisch-französische Jugendkultur) | Grußformel oder Provokation („Ey“, „Was geht“) |
| t’es relou | tu es lourd (verlan) | Du nervst, du bist anstrengend |
| relou | lourd (verlan) | nervig, unangenehm |
| puis-je | Konjugation von pouvoir im Inversionssatz (formales Schriftfranzösisch) | Formelles „Darf ich?“ – in Alltagssprache selten |
| La vie est belle | Standardfloskel / Werbesprache (u. a. Lancôme-Slogan) | Klischeehafter Postkartenspruch, „Das Leben ist schön“ |
| gros daron | daron = Vater (slang) | Großer Boss, Respektperson (meist ironisch) |
| subjonctif passé | zusammengesetzte Zeitform des Konjunktivs (subjonctif) in der französischen Grammatik | Hochkomplexe grammatikalische Zeitform, fast nie gesprochen |
Hinweis zur Zweisprachigkeit dieses Essays:
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst – für ein deutschsprachiges Publikum, das die soziale Tiefenschichtung der französischen Sprache aus einer Außenperspektive reflektiert. Eine bloße Übersetzung ins Französische wäre hier nicht sinnvoll, da viele Beobachtungen und Irritationen aus dem spezifischen Blickwinkel deutscher Sprach- und Bildungserfahrung formuliert sind.
Aus diesem Grund existiert auf La Dernière Cartouche eine eigene französische Fassung – kein Duplikat, sondern eine autonome Reflexion, die sich an französische Leser:innen richtet und aus der Binnenrealität der Sprache heraus spricht.
Gerade für frankophile Leser:innen lohnt sich der Vergleich beider Versionen:
Sie erzählen von denselben Spannungen – aber sie tun es auf je eigene Weise. Und genau darin liegt der Schlüssel zum Verstehen. Nicht nur der Sprache – sondern des Raums dazwischen.
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!







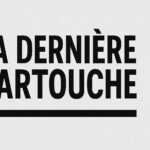 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















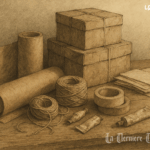 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Ein großartiger Text! Gern gelesen!