![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
La voix qu’on abandonne
Warum deutsche Radiosender Angst vor Sprache haben
Frankreich schützt seine Sprache. Deutschland schützt seine Ausrede. Seit 1994 verpflichtet das Loi Toubon französische Radiosender, mindestens 40 Prozent französischsprachige Musik zu spielen – ein Gesetz, das im deutschen Radiobetrieb regelmäßig für Spott sorgt. Die Argumente sind bekannt: Bevormundung, Marktfremdheit, angebliche Hörerfeindlichkeit. Doch die eigentliche Frage lautet: Was genau wird hier verteidigt? Die Freiheit der Sprache – oder die Freiheit von Verantwortung? Während Frankreich musikalische Talente über Sprache integriert, trennt der deutsche Markt beides voneinander. Sprache gilt als sperrig, riskant, uncool. Deutschsprachige Popmusik wird zur stilistischen Nische: hyperprivat, kalkuliert gefällig oder so ironisch abgeklärt, dass sie nicht mehr berührt. Es ist ein Klangbild, das sich selbst genügen will – weichgespült, redundant, maximal konsumierbar. Man hört wenig, weil wenig gesagt wird. Man spürt kaum etwas, weil nichts gewagt wird.
In Frankreich ist die Quote ein kulturelles Bekenntnis, ein Instrument der Selbstachtung. In Deutschland wäre sie ein Fremdkörper in einem System, das sich längst auf einen algorithmischen Mittelwert geeinigt hat. Der Unterschied ist nicht technischer, sondern kultureller Natur. In Saargemünd spielt Radio Mélodie französisch, weil das Publikum es so will. Bei ICI Lorraine sagt der Programmchef: „Wir stellen den kulturellen Reichtum ins Zentrum.“ In Deutschland hingegen lautet der Leitsatz vieler Privatsender: „Wir wollen die Leute glücklich machen.“ Was harmlos klingt, entlarvt sich als Entkernung eines ganzen Mediums – denn das Versprechen von Glück ersetzt keine Haltung.
Die französische Musikquote ist keine Nostalgiepolitik. Sie ist eine kulturelle Verteidigungslinie gegen die globale Entwertung von Sprache. Sie sagt: Sprache ist Herkunft. Musik ist nicht nur Klang, sondern Stimme in einem Raum, der mehr sein will als bloß Echo. Radio kann Resonanzkörper sein oder Geräuschteppich – und diese Entscheidung ist nicht neutral. Was in Deutschland niemand laut sagt: Vielleicht braucht es keine Quote. Aber es braucht den Mut, auszusprechen, dass ein Großteil deutschsprachiger Chartmusik schlicht nicht gut genug ist, um gewollt zu werden. Das Problem ist nicht die Sprache. Das Problem ist, was aus ihr gemacht wird.
Eine verlorene Stimme kehrt nicht zurück, weil man sie vermisst, sondern weil man sie wieder hören will. Vielleicht wird irgendwann jemand in Deutschland sagen: Nicht mehr Deutsch im Radio – sondern besseres. Nicht mehr Feelgood – sondern mehr Haltung. Nicht mehr Echo – sondern endlich wieder Stimme. Bis dahin bleibt uns die französische Quote. Nicht als Vorbild. Sondern als Mahnung.

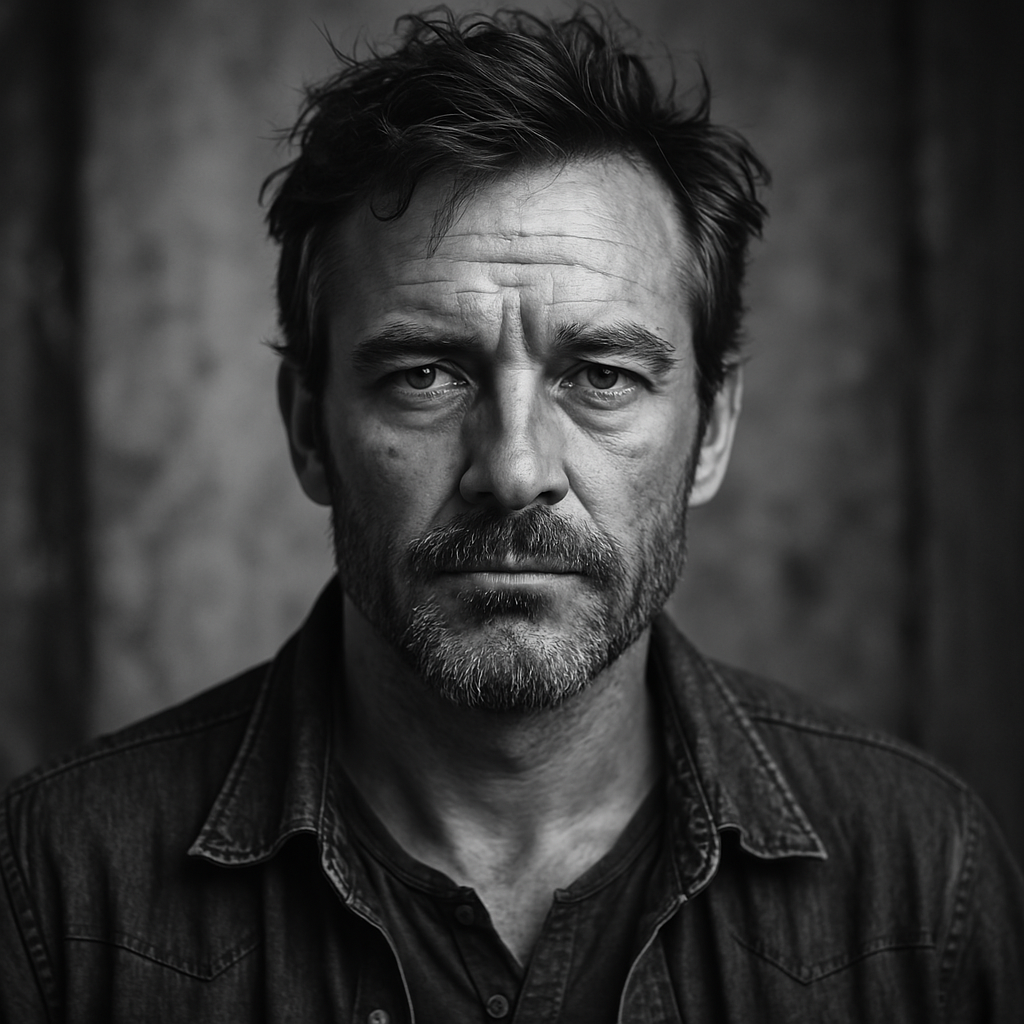





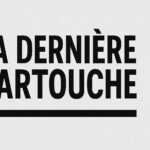 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
























Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.