![]()
Dieser Artikel ist noch nicht in Französischer Sprache verfügbar
Wann beginnt der Krieg in Europa?
Es gibt Sätze, die fallen erst, wenn alles vorbei ist. „Wir haben nicht gemerkt, wann es begann.“ Man sagt sie, wenn die Trümmer geräumt werden, wenn die Archive geöffnet sind, wenn man plötzlich erkennt, dass der Anfang lange vor dem ersten Knall lag. Die meisten Kriege beginnen nicht mit einem Schuss, sie beginnen mit Worten. Und einer Sprache, die sich verdichtet, die Grenzen verschiebt und die das Unaussprechliche in das Reich des Möglichen überführt. Sie schaffen eine Vorbedingung, eine mentale Topografie des Konflikts, lange bevor Panzer rollen oder Raketen steigen. Der „Vor-Krieg“ ist kein militärischer Zustand, sondern ein rhetorischer, psychologischer und diplomatischer. Er ist die Zeit, in der die Worte selbst zu Waffen werden, die die Grundfesten des Friedens untergraben.
🔗Ein Essay auf Globalbridge prägte den Begriff „Vor-Krieg“. Das Wort ist unscheinbar und gerade deshalb präzise. Kein Alarmruf, kein Schlagwort für Schlagzeilen, sondern ein nüchterner Befund: nicht mehr Frieden, noch nicht Krieg. Es ist ein Zustand der Ambivalenz, in dem die Gewissheit des Friedens zerbricht, ohne dass die Klarheit des Krieges eintritt. Der Text sammelt Stimmen, die diesen Befund stützen – Worte von Osten und Westen, von Ministern und Präsidenten, von Generälen und Kommentatoren. Worte, die härter geworden sind. Worte, die den Frieden mit jedem Satz dünner machen. Sie sind nicht nur Ausdruck einer Haltung, sondern Akte der Kommunikation, die auf Eskalation abzielen, bewusst oder unbewusst. Die rhetorischen Frontlinien werden gezogen, die mentalen Vorbereitungen für das Undenkbare getroffen. Christa Wolfs Kassandra warnte einst: „Lasst euch nicht von den Eigenen täuschen!“ Eine Mahnung, die heute eine neue, beklemmende Relevanz gewinnt, da die „Eigenen“ ihre Pläne möglicherweise nicht verbergen, sondern offen aussprechen, in der Annahme, dass man ihnen ohnehin nicht glauben will.
Russland und der Westen sprechen in diesen Wochen nicht miteinander, sie sprechen übereinander. Und sie tun es in einer Sprache, die Fronten zieht, bevor die Soldaten es tun. Diese Kommunikation ist ein Spiegelbild der tiefen geopolitischen Verwerfungen, die sich in den letzten Jahrzehnten akkumuliert haben. Sie ist die Manifestation eines neuen Kalten Krieges, der sich nicht mehr nur im Wettrüsten und Stellvertreterkonflikten äußert, sondern auch in einer präzisen und oft aggressiven Sprachführung. Jedes Wort ist gewichtet, jede Aussage eine bewusste Positionierung im globalen Machtspiel. Es ist eine Rhetorik, die darauf abzielt, narratives Terrain zu gewinnen, Feindbilder zu festigen und die eigene Bevölkerung auf eine mögliche Konfrontation vorzubereiten. Die Trennlinien sind nicht mehr nur ideologisch, sondern werden durch eine ständige Eskalation der Wortwahl immer tiefer gezogen. Die Frage, wann der Vor-Krieg beginnt, ist nicht nur eine chronologische, sondern eine qualitative: Wann kippt die Sprache so, dass sie die Möglichkeit des Krieges nicht mehr als ferne Option, sondern als nahe Realität etabliert?
Maria Sacharowa tritt in Moskau vor die Mikrofone. Ihre Stimme gehört ihr, ihre Worte nicht. Sie spricht als Instrument eines Systems. Jeder Satz ist von der Linie gezeichnet, die Sergej Lawrow zieht, von der Pose, die Wladimir Putin vorgibt. „Wir haben verziehen, was man nicht verzeihen kann. Wir haben alles verziehen – aber nicht vergessen.“ Diese Worte klingen wie eine Geste, aber sie sind eine Buchhaltung. Vergebung, die in der Schublade liegt wie eine offene Rechnung. Die Botschaft ist deutlich: Russland stellt sich dar als die Nation, die verzeiht – und als die Nation, die nicht vergessen hat, wem sie verziehen hat. Es ist eine alte Technik: Schuld wird nicht aufgelöst, sie wird aufbewahrt. Als Druckmittel, als Drohung, als moralisches Kapital. Die russische Rhetorik, insbesondere jene, die von offiziellen Vertretern wie Sacharowa artikuliert wird, ist tief in historischen Narrativen verwurzelt, die das Leiden und die Opferbereitschaft Russlands betonen. Es ist eine Sprache, die Ressentiments pflegt und die Geschichte als eine Kette von Ungerechtigkeiten darstellt, die es zu korrigieren gilt. Die Vergangenheit wird nicht nur erinnert, sondern aktiv zur Legitimation gegenwärtiger und zukünftiger Handlungen genutzt. Die „Vergebung“, die angeblich gewährt wurde, ist stets an Bedingungen geknüpft und kann jederzeit widerrufen werden, sobald es der politischen Agenda dient. Dies schafft eine Atmosphäre der ständigen Bedrohung und des Misstrauens, in der diplomatische Lösungen zunehmend schwieriger werden. Es ist eine Sprache, die sowohl nach innen als auch nach außen wirkt: Sie mobilisiert die eigene Bevölkerung und projiziert gleichzeitig ein Bild von unnachgiebiger Entschlossenheit nach außen. Die wiederholte Betonung historischer „Demütigungen“ und „Verrätereien“ dient dazu, eine kollektive Opfermentalität zu festigen, die Aggression als notwendige Selbstverteidigung erscheinen lässt.
Aber Russland spricht nicht nur – Russland kämpft. Seit Februar 2022 führt es Krieg gegen die Ukraine. Was als „militärische Spezialoperation“ begann, sollte ein schneller Vorstoß werden. Die russischen Panzer sollten in Tagen in Kiew stehen, in Wochen eine neue Ordnung erzwingen. Heute, mehr als drei Jahre später, hat sich dieser Plan in einen Abnutzungskrieg verwandelt. Russland hat kaum nennenswerte Geländegewinne gemacht. Die Frontlinien verschieben sich in Metern, nicht in Städten. Die Realität des Schlachtfeldes widerspricht oft der hochfliegenden Rhetorik des Kremls. Die anfänglichen Ziele der „Spezialoperation“ wurden nicht erreicht, und der Konflikt hat sich zu einem zermürbenden Stellungskrieg entwickelt, der immense personelle und materielle Ressourcen bindet. Diese militärische Realität muss in Relation zur aggressiven Rhetorik gesetzt werden. Der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist eklatant. Trotz der verbalen Härte und der Drohungen scheint die militärische Kapazität Russlands, über die Grenzen der Ukraine hinaus eine direkte Konfrontation mit der NATO zu suchen, begrenzt zu sein. Die Verluste an Personal und Ausrüstung sind erheblich, und die Umstellung der Wirtschaft auf Kriegsproduktion, obwohl sie beeindruckende Fortschritte gemacht hat, kann die Lücke zu den kombinierten Fähigkeiten der NATO-Staaten nicht schließen. Der Krieg in der Ukraine offenbart die Grenzen der russischen Militärmacht und zwingt den Kreml, seine strategischen Ambitionen neu zu kalibrieren. Die militärische Bindung in der Ukraine ist ein entscheidender Faktor, der die Glaubwürdigkeit der russischen Drohungen gegenüber der NATO relativiert.
Die Ursache ist klar: Die Ukraine kämpft nicht allein. Hinter ihr steht fast die gesamte westliche Welt. Waffen, Milliarden, Geheimdienste, Ausbildung. Offiziell keine NATO-Soldaten, aber alles andere. Diese Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung für die Fähigkeit der Ukraine, den russischen Angriffen standzuhalten. Sie ist ein indirekter, aber substanzieller Eingriff in den Konflikt. Hier wird die eigentliche Frage sichtbar, die in Schlagzeilen selten auftaucht: Ist Russland überhaupt in der Lage – oder willens – einen NATO-Staat anzugreifen? Die Zahlen sind eindeutig. Russlands Verteidigungshaushalt liegt bei knapp 100 Milliarden Dollar. Die NATO gibt mehr als 1,3 Billionen aus. Allein die USA investieren mehr in ihre Streitkräfte als Russland, China, Indien und zwanzig weitere Länder zusammen. Russland ist groß, aber nicht grenzenlos. Seine Armee ist gebunden, seine Wirtschaft ist angeschlagen, sein Material verschlissen. Die militärische Überlegenheit der NATO ist erdrückend. Jede Eskalation über die Ukraine hinaus würde Russland vor eine existentielle Herausforderung stellen, deren Ausgang kaum zugunsten Moskaus ausfallen könnte. Die Drohungen Russlands, NATO-Staaten anzugreifen, müssen daher sorgfältig analysiert werden: Handelt es sich um eine Pose, die darauf abzielt, den Westen einzuschüchtern und die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben, oder um einen ernsthaften Plan, der die militärischen Realitäten ignoriert? Die Rhetorik der nuklearen Eskalation dient oft dazu, konventionelle Schwächen zu kompensieren. Die russische Führung ist sich der Asymmetrie der konventionellen Kräfte bewusst, und ihre Drohungen müssen als Teil einer psychologischen Kriegsführung verstanden werden, die darauf abzielt, die Entschlossenheit des Westens zu testen und zu untergraben.
Putin spricht von „historischem Russland“, vom Zarenreich, von Grenzen, die einst anders verliefen. Er pflegt die Pose des Wiederherstellers, die Nostalgie des Imperiums. Aber Pose und Plan sind nicht dasselbe. Träume marschieren nicht von selbst. Die Verklärung der Geschichte und die Beschwörung vergangener Größe sind zentrale Elemente der russischen Staatspropaganda. Sie dienen dazu, imperiale Ambitionen zu legitimieren und eine revisionistische Agenda zu verfolgen. Diese Narrative sind tief in der nationalen Identität Russlands verankert und werden genutzt, um die Bevölkerung auf die Notwendigkeit von Opfer und Kampf einzustimmen. Der Wunsch nach Wiederherstellung einer Großmachtstellung und die Ablehnung der nach 1991 etablierten Weltordnung sind treibende Kräfte hinter der russischen Außenpolitik. Doch die Kluft zwischen historischer Romantik und der Realität militärischer und wirtschaftlicher Kapazitäten ist beträchtlich. Die Behauptung, dass Russland seine Grenzen ausdehnen will, muss im Kontext seiner aktuellen militärischen Verwicklungen und seiner wirtschaftlichen Verwundbarkeit betrachtet werden. Es ist eine Frage, inwieweit die aggressive Rhetorik tatsächlich von der Fähigkeit und dem Willen zur Ausführung begleitet wird.
Und doch reicht Pose oft, um Angst zu erzeugen. Die Unsicherheit über die wahren Absichten und Fähigkeiten einer Nuklearmacht ist ein mächtiges Instrument der Beeinflussung. Auch auf westlicher Seite ist die Sprache längst keine Sprache des Friedens mehr. Der Globalbridge-Essay hat sie präzise gesammelt, diese Stimmen, die das Klima des Vor-Kriegs schaffen. Mark Rutte, NATO-Generalsekretär, präsentiert sich stolz lächelnd und verkündet das Ziel, die NATO müsse „tödlicher“ werden („more lethal“). Friedrich Merz konstatiert lapidar: „Frieden gibt’s auf jedem Friedhof.“ Johann Wadephul erklärt, „Russland wird immer ein Feind für uns bleiben.“ Frank-Walter Steinmeier fragt in den Raum, ob wir bereit sind, „empfindliche Nachteile in Kauf zu nehmen.“ Boris Pistorius fordert unmissverständlich: „Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein.“ Peter Sloterdijk entdeckt mit einer gewissen intellektuellen Provokation: „Europa erlebt derzeit, historisch gesehen, etwas, das einem Glück gleicht. Wir haben wieder Feinde. Echte Feinde.“ Annalena Baerbock konstatierte: „We are fighting a war against Russia.“ Carola Rackete fordert, „die EU muss weiterhin Waffen an Kiew liefern und zulassen, dass es auf russischem Territorium angreift.“ Roderich Kiesewetter präzisiert die Forderung: „Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Nicht nur Ölraffinerien, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände.“ Florence Gaub bemerkt, „dass Russen europäisch aussehen – dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne.“ Anton Hofreiter sieht „einen Vernichtungskrieg mitten in Europa.“ Marie-Agnes Strack-Zimmermann charakterisiert Wladimir Putin als „Mörder, ein Killer, der Hunderte von Millionen Menschen unter die Erde gebracht hat.“ Ursula von der Leyen kündigt an: „Wir schalten bei der Verteidigung einen Gang hoch.“ Annalena Baerbock prophezeit: „Das wird Russland ruinieren!“ Carlo Masala wünscht sich „eine Bundeswehr, die woke im besten Sinne des Wortes ist, wehrhaft und bis an die Zähne bewaffnet.“ Egon Flaig beklagt „die Unwilligkeit von Eltern, ihre Kinder als Soldaten zu sehen, die eventuell geopfert werden für das Gemeinwesen.“ Caren Miosga fragt zur „deutschen Pazifismus-DNA“: „Wie können wir diesen Code schneller überschreiben?“ Stefanie Babst fragt provokativ: „Wollen wir wirklich dauerhaft mit einem brutalen Mafiaboss in unserer Nachbarschaft leben und uns alle zwei Tage nuklear erpressen lassen?“ Florence Gaub erinnert: „Nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst davor!“ Joschka Fischer fordert: „Die EU braucht eine eigene atomare Abschreckung.“ Olaf Scholz spricht von erhöhter Sicherheit durch die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Claudia Major konstatiert: „Der Krieg ist schon da. Er ist in einem Graubereich, aber hybrid ist er da.“ André Wüstner fordert: „Wir müssen endlich in eine Art Kriegswirtschaft.“ Herfried Münkler mahnt: „Wer keine Kampfdrohnen anschaffen will, kann auch den Rest vergessen!“ Ein gemeinsames Dossier aller transatlantischen Think Tanks in Deutschland titelt: „Transatlantisch? Traut euch!“ Mark Rutte bemerkt: „Europe is going to pay in a BIG way, as they should.“ Udo Lindenberg, einst ein Symbol des Friedens, resigniert: „Wir haben uns das anders gewünscht, aber es muss wohl sein, dass wir uns verteidigungsbereit machen müssen.“ Der Reservistenverband verkündet: „Bereit sein ist alles!“ Hannah Neumann, MEP der Grünen, erklärt: „I am ready to defend this Union with weapons if need be.“ Sönke Neitzel warnt: „Das könnte unser letzter Sommer im Frieden sein.“ Friedrich Merz skizziert eine Eskalationsleiter: „Wenn das nicht aufhört mit den Bombardements, dann ist der erste Schritt der: Reichweiten-Begrenzung aufheben. Und der zweite Schritt der, dass wir die Taurus liefern. Und dann hat Putin es in der Hand, wie weit er diesen Krieg noch weiter eskalieren will.“ Kaja Kallas sieht in einer Niederlage Russlands keinen Nachteil: „Das Land besteht aus vielen verschiedenen Nationen und nach dem Krieg könnten daraus separate Staaten entstehen. Es wäre vorteilhaft, wenn eine Großmacht deutlich an Größe verliert.“ Sascha Lobo brandmarkt „Lumpen-Pazifisten“ als „selbstgerecht.“ Wolfgang Niedecken von BAP empfindet Mitleid für die Ostermarschierer.
Das sind keine Nebensätze. Das sind Wegmarken. Die westliche Rhetorik, obwohl oft als Reaktion auf die russische Aggression dargestellt, trägt ebenfalls zur Eskalation bei. Die Forderung nach einer „dauerhaften Schwächung“ Russlands ist eine Kriegserklärung in nuce, die die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz negiert. Die Betonung von „Stärke“ und die Vorbereitung auf eine „direkte Konfrontation“ schaffen eine Atmosphäre, in der diplomatische Lösungen als Schwäche ausgelegt werden können. Die europäische Debatte, angeführt von Figuren wie Macron und Baerbock, spiegelt eine wachsende Entschlossenheit wider, die russische Bedrohung ernst zu nehmen und sich entsprechend zu positionieren. Diese Haltung ist verständlich angesichts der russischen Aggression in der Ukraine, doch sie birgt die Gefahr einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Sprache der Verteidigung kann leicht in die Sprache der Konfrontation übergehen, und die Linie zwischen Abschreckung und Eskalation verschwimmt. Die westliche Rhetorik ist nicht monolithisch; sie variiert zwischen den nationalen Interessen und politischen Kulturen. Doch der gemeinsame Nenner ist eine zunehmend kompromisslose Haltung gegenüber Moskau, die wenig Raum für Kompromisse lässt. Die Kumulation dieser Aussagen, die von Politikern, Militärs, Intellektuellen und Künstlern stammen, zeichnet ein Bild einer Gesellschaft, die sich auf Krieg einstellt, ihn mental vorwegnimmt, vielleicht sogar herbeisehnt, ohne ihn als solchen zu benennen.
Sprache macht aus dem Unaussprechlichen etwas Sagbares. „Wir liefern Waffen zur Verteidigung“ – und plötzlich sind es Offensivwaffen. „Wir unterstützen“ – und plötzlich führen wir einen Krieg, den wir nicht Krieg nennen. Die Euphemismen der Kriegsführung sind eine Form der Selbsttäuschung und der öffentlichen Täuschung. Sie ermöglichen es, Handlungen zu rechtfertigen, die unter anderen Umständen als unakzeptabel gelten würden. Die Verschiebung der Terminologie spiegelt eine Verschiebung der Realität wider. Was als humanitäre Hilfe begann, entwickelte sich zu umfassender militärischer Unterstützung, die direkt in den Konflikt eingreift. Die Grenzen der Neutralität verschwimmen, und die Beteiligung am Konflikt wird zunehmend direkt, auch wenn sie offiziell geleugnet wird. Diese sprachliche Transformation ist ein Symptom des „Vor-Krieges“: Die Normalisierung von Kriegshandlungen durch die Umbenennung ihrer Natur. Das direkte Eingreifen durch Waffenlieferungen und Geheimdienstunterstützung ist eine Form der Kriegsführung, die nicht offen als solche bezeichnet wird. Dies schafft eine gefährliche Grauzone, in der die Regeln des internationalen Rechts und der Kriegsführung unklar bleiben. Die Akzeptanz dieser sprachlichen Verschiebungen ist ein Zeichen dafür, wie tief der Vor-Krieg bereits in das kollektive Bewusstsein eingedrungen ist.
Das Muster ist bekannt. Historische Parallelen dienen nicht der einfachen Gleichsetzung, sondern der Erkenntnis wiederkehrender Dynamiken. 1913 sprach man von „angespannter Ruhe“. Man rechnete mit Krieg, aber man verstand nicht, dass er bereits in der Luft lag, in den diplomatischen Depeschen, in den militärischen Plänen, in den nationalen Narrativen. 1938 sprach man von „Verhandlungen“. Man verhandelte, während die Weichen für einen Kontinent in Flammen gestellt wurden. Man sprach, als wäre Zeit ein Besitz, als könnte man sie beliebig strecken. Aber Zeit ist kein Besitz. Sie verrinnt. Die Illusion der Kontrolle und die Selbsttäuschung über die wahre Natur der Bedrohung sind wiederkehrende Merkmale des „Vor-Krieges“. Man klammert sich an diplomatische Floskeln, während die Realität des Konflikts immer offensichtlicher wird. Das Scheitern, die Vorzeichen zu erkennen, ist oft eine Folge der Weigerung, die Konsequenzen der eigenen Handlungen oder der Handlungen anderer vollständig zu akzeptieren. Die historische Tiefenschicht zeigt, dass Kriege selten aus dem Nichts entstehen. Sie sind das Ergebnis einer langen Kette von Entscheidungen, Missverständnissen und rhetorischen Eskalationen, die sich über Jahre oder Jahrzehnte erstrecken können. Die Geschwindigkeit, mit der die Sprache der Konfrontation salonfähig wurde, erinnert an jene historischen Momente, in denen die Schwelle zum Krieg unmerklich überschritten wurde, bevor die erste Granate einschlug.
Und 1991? Das Ende der Sowjetunion hätte ein Neuanfang sein können. Ein Europa ohne Fronten, ein Russland ohne imperialen Reflex. Ein Moment der historischen Chance. Doch die 1990er waren kein Aufbruch, sie waren ein Zerfall. In Moskau kam Wut, Demütigung, der Reflex, Geschichte zurückzuholen. In Washington und Brüssel kam die Versuchung, das Vakuum zu füllen, die Grenzen der eigenen Einflusszone nach Osten zu verschieben. Die Erweiterung der NATO und der Europäischen Union wurde von Russland oft als Bedrohung empfunden, als ein Vordringen in die eigene Interessensphäre. Diese Entwicklungen nährten in Moskau eine tiefe Ressentiment gegen den Westen und trugen zur Entstehung eines revisionistischen Narrativs bei. Die Hoffnungen auf eine „Friedensdividende“ nach dem Kalten Krieg zerschlugen sich in der Realität einer sich neu ordnenden Welt. Das Versprechen einer geeinten und friedlichen europäischen Ordnung wurde durch die unterschiedlichen Interpretationen der Nachkriegsordnung und die konkurrierenden Sicherheitsinteressen untergraben. Die Fehler und Versäumnisse auf beiden Seiten haben dazu beigetragen, dass die Linien, die man glaubte, überwunden zu haben, sich nun wieder verfestigen. Die gegenwärtige Konfrontation ist nicht nur das Ergebnis jüngster Ereignisse, sondern auch die Konsequenz einer verpassten Chance, eine inklusive Sicherheitsarchitektur für ganz Europa zu schaffen.
Jetzt, 2025, sind die Linien wieder da. Die geopolitische Landschaft Europas ist von einer neuen Bipolarität geprägt, die sich in militärischen Allianzen, Wirtschaftsblöcken und rhetorischen Feindbildern manifestiert. Max Frischs Biedermann steht wieder auf der Bühne, und seine Dialoge mit Eisenring hallen in der Gegenwart wider:
„Biedermann: Herr Eisenring, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, offen gesprochen: – ist wirklich Benzin in diesen Fässern? Eisenring: Sie trauen uns nicht? Biedermann: Ich frag ja nur. Eisenring: Wofür halten Sie uns, Herr Biedermann, offen gesprochen: – wofür eigentlich? Biedermann: Sie müssen nicht denken, mein Freund, dass ich keinen Humor habe, aber Ihr habt eine Art zu scherzen, ich muss schon sagen. Eisenring: Wir lernen das. Biedermann: Was? Eisenring: Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste: Sentimentalität. Aber die beste und sicherste Tarnung (finde ich) ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand.“
Diese Passage ist der Kern der gegenwärtigen Situation. Die „Eigenen“ – die politischen Führer, die Militärstrategen, die meinungsbildenden Intellektuellen – sprechen die „blanke und nackte Wahrheit“ aus. Sie fordern Kriegstüchtigkeit, benennen Feinde, skizzieren Eskalationsszenarien. Doch die Öffentlichkeit, der „Biedermann“, will es nicht glauben. Man interpretiert es als Scherz, als Übertreibung, als notwendige Rhetorik, aber nicht als ernsthafte Absicht. Die Metapher des Biedermanns ist nicht bequem, sie ist eine Anklage: nicht nur an die Brandstifter, sondern an jene, die die Zeichen nicht lesen wollen. Wer ist Biedermann? Wer sind die Brandstifter? Russland? Die NATO? Die eigenen Regierungen? Manchmal ist es nicht klar. Manchmal sind es dieselben. Manchmal löscht man Feuer mit einer Hand und legt mit der anderen neues Holz auf. Die Komplexität der gegenwärtigen Situation lässt sich nicht auf einfache Schuldzuweisungen reduzieren. Die Interdependenzen und die Dynamik von Aktion und Reaktion führen dazu, dass alle Akteure gleichermaßen in die Eskalationsspirale verwickelt sind. Die Metapher des Biedermanns vereinfacht eine Situation, die von multiplen Akteuren mit komplexen Motivationen und unterschiedlichen Interessen geprägt ist. Sie lenkt von der eigenen Verantwortung ab und suggeriert eine passive Opferrolle, die der Realität nicht gerecht wird. Das eigentliche Problem ist vielleicht nicht, dass die „Eigenen“ täuschen, sondern dass man ihnen nicht glauben will, weil die Wahrheit zu unbequem ist, zu beängstigend, zu sehr im Widerspruch zum gewünschten Bild des Friedens.
Und während die Metaphern kreisen, während Worte härter werden, während Sanktionen und Drohungen, Übungen und Aufrüstungen sich stapeln, bleibt die Frage: Wann wird dieser neue Kalte Krieg heiß? Die Anzeichen verdichten sich, die Eskalation ist spürbar, doch der endgültige Übergang zum offenen, flächendeckenden Konflikt ist noch nicht vollzogen. Vielleicht ist er schon heißer, als wir glauben. Vielleicht ist er längst mehr als kalt, aber noch nicht so heiß, dass wir ihn „Krieg“ nennen. Die konventionellen Definitionen von Krieg erfassen möglicherweise nicht mehr die gesamte Bandbreite der modernen Konflikte. Cyberangriffe, Informationskrieg, wirtschaftliche Sanktionen, Stellvertreterkriege – all dies sind Formen der Konfrontation, die die Schwelle zum traditionellen Krieg überschreiten, ohne als solcher deklariert zu werden. Die „Grauzone“, von der Claudia Major spricht, ist nicht nur ein Zustand des Übergangs, sondern eine eigene Form des Konflikts, die die traditionellen Kategorien herausfordert.
Vielleicht beginnt er nicht, wenn die erste Rakete auf Warschau fällt. Vielleicht hat er längst begonnen – in Sätzen, in Drohungen, in Reden, in der Normalisierung einer Sprache, die nicht mehr Frieden spricht, sondern die Möglichkeit des Krieges in den Bereich des Alltäglichen rückt. Krieg beginnt nicht immer mit einem Schuss. Manchmal beginnt er, wenn man nicht mehr merkt, dass man ihn schon führt. Wenn die kollektive Wahrnehmung so weit verschoben ist, dass der Frieden als Illusion und der Konflikt als unausweichliche Realität angesehen wird. Wenn die „blanke und nackte Wahrheit“ über die Kriegsabsichten so offen ausgesprochen wird, dass sie niemand mehr glaubt, gerade weil sie so offensichtlich ist.
Sind wir schon im Krieg – und nennen ihn nur noch nicht so?

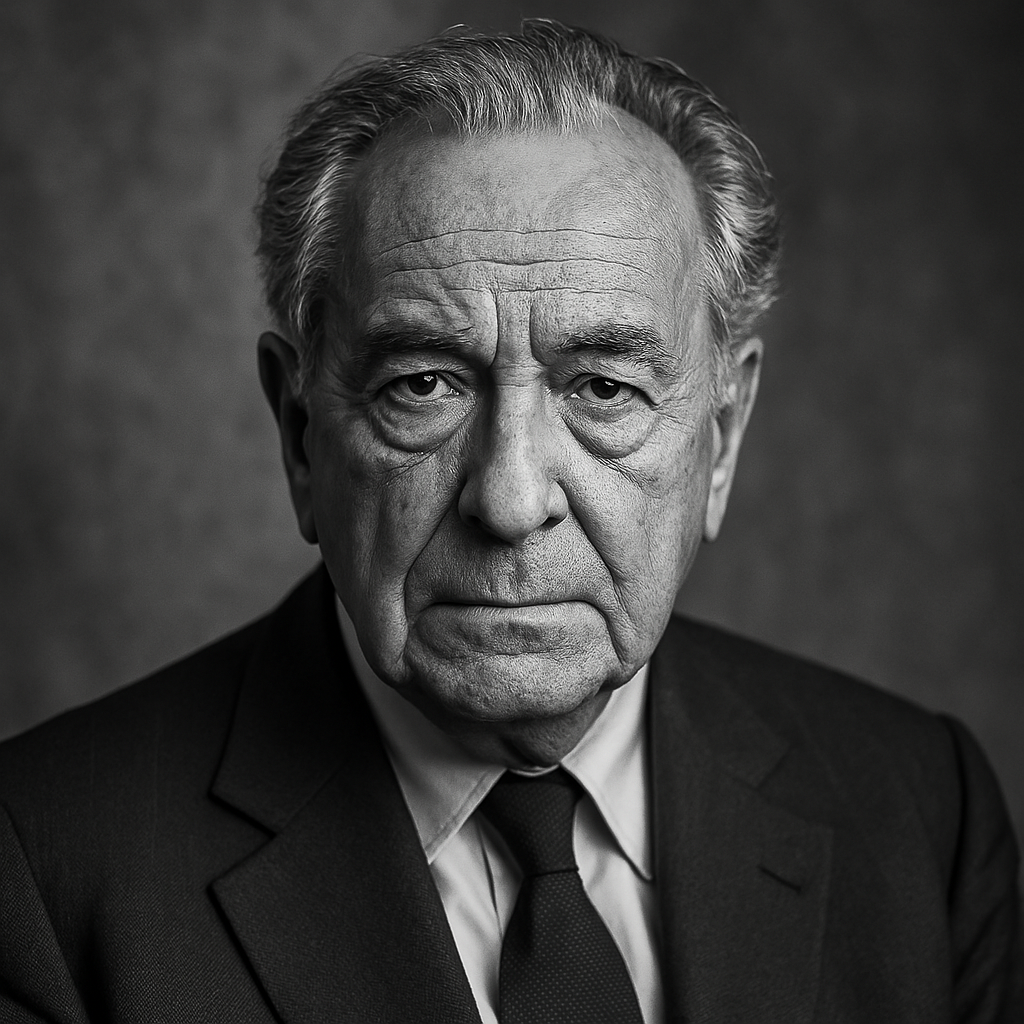

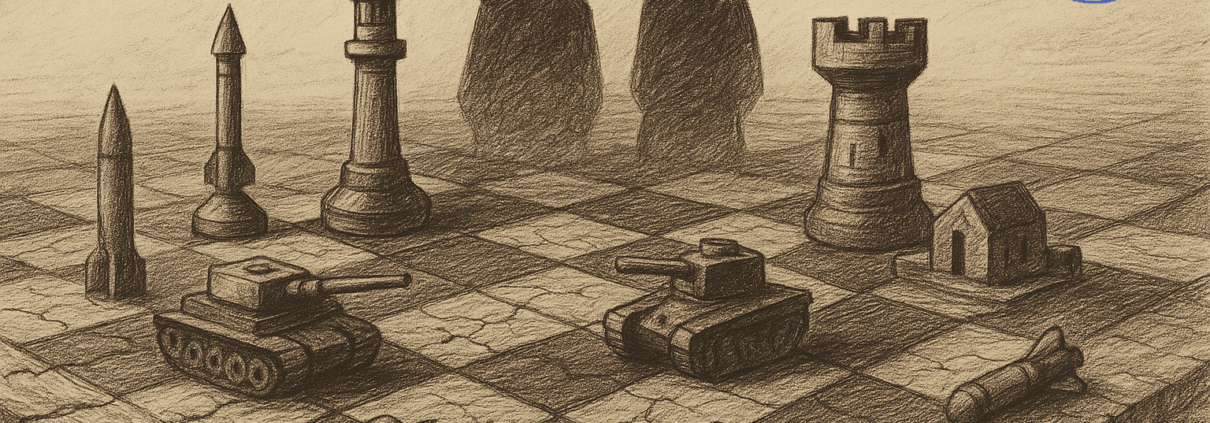

 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche
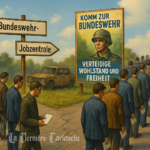 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche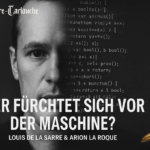 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche





















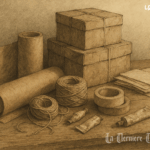 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS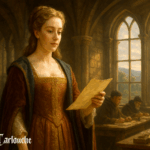 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.