![]()
Eurasien im Schatten des Unfriedens
Eurasische Geopolitik 2025 – Machtachsen und ungelöste Konflikte
Ein Essay für PENROSE
Es gehört zu den hartnäckigen Illusionen unserer Gegenwart, dass sich moderne Kriege durch moralische Empörung oder wohlmeinende Appelle beenden ließen. Wer versucht, den Ukrainekrieg oder die wiederkehrenden Eruptionen im Nahen Osten mit Kategorien wie „Werten“, „Fehlern“ oder „Versäumnissen der Diplomatie“ zu erklären, greift ins Leere, weil die eigentlichen Ursachen unter diesem moralischen Überzug verborgen bleiben. Die Welt der Macht, in der diese Kriege wurzeln, folgt älteren Gesetzen: jenen der Räume, der Zugänge, der Verwundbarkeiten und der historischen Sicherheiten. Wer das nicht anerkennt, versteht weder die Härte des Geschehens noch die merkwürdige Trägheit, die jede Friedensinitiative sofort erstickt.
Seit Halford Mackinder den eurasischen Raum als das „Pivot der Geschichte“ bezeichnete – nicht aus Ideologie, sondern aus nüchterner Beobachtung –, gilt die Einsicht, dass die großen Machtfragen der Moderne sich immer wieder auf der riesigen Landmasse zwischen Lissabon und Wladiwostok entscheiden. Die Kontinuität dieser Einsicht ist bemerkenswert: Sie hat die geographischen Imperative Russlands geprägt, die maritime Gegenstrategie der Vereinigten Staaten, die künstliche und allzu oft widersprüchliche Lage Europas und die Durchdringung des Nahen Ostens durch externe Mächte. Nichts davon ist veraltet; alles ist im gegenwärtigen Weltzustand zu spüren.
Russlands Handeln lässt sich kaum verstehen, wenn man nicht akzeptiert, wie tief die Erfahrung der Verwundbarkeit in diesem Land sitzt. Nicht erst seit Putin, nicht erst seit dem Kalten Krieg, sondern seit Jahrhunderten. Ein Reich ohne natürliche Grenzen lebt mit dem reflexartigen Bedürfnis nach Tiefe – nach Räumen, die Angreifer vom Kern fernhalten. Die Ukraine liegt nicht einfach „daneben“, sie liegt im Zentrum dieser historischen Sicherheitslogik. Sie ist ein industrielles Rückgrat, ein logistischer Durchgangsraum, ein kultureller Zwilling und ein militärischer Vorhang. Wer aus westlicher Perspektive glaubt, Russland könne eine neutrale, westlich orientierte oder in die NATO integrierte Ukraine akzeptieren, verwechselt Wunschbilder mit strategischer Realität. Ein Frieden, der Russland in seiner eigenen Wahrnehmung entkernt, wäre für Moskau kein Frieden, sondern eine existenzielle Falle. In dieser Logik ist Härte kein Ausdruck persönlicher Sturheit, sondern die Fortsetzung geopolitischer Selbstbehauptung mit modernen Mitteln.
Auf der anderen Seite des eurasischen Kontinents steht eine Macht, deren strategisches Denken von einer erstaunlichen Konstanz getragen wird. Die Vereinigten Staaten haben in ihren offiziellen Sicherheitsstrategien immer wieder denselben Satz wiederholt: dass kein Machtblock die eurasische Landmasse dominieren darf. Das ist keine Dekoration, sondern der Kern ihrer Weltpolitik seit 1945. Eine geeinte oder auch nur stabil integrierte Großregion, die Europa, Russland und China verbindet, wäre das einzige Gebilde, das die amerikanische Vormachtstellung unterlaufen könnte. Deshalb ist Washingtons Blick auf die Ukraine nicht jener eines moralischen Missionars, sondern eines sorgfältigen Schachspielers. Ein Krieg, der Russland schwächt, Europa an die USA bindet und China indirekt beschäftigt, verändert für Washingtons strategische Position wenig zum Schlechteren. Ein Frieden hingegen, der Russland ermöglicht, sich zu stabilisieren, der Europa die Rückkehr zu günstiger Energie erlaubte und China die Entlastung seiner westlichen Flanke verschaffen würde, könnte das geopolitische Gefüge ins Rutschen bringen. So entsteht ein paradoxer Zustand: Nicht weil man Krieg wollte, sondern weil seine Beendigung komplexer ist als sein Fortgang, fehlt die Dynamik zur Deeskalation.
Europa steht dazwischen – ökonomisch abhängig von offenen Märkten, energiepolitisch verwundet und sicherheitspolitisch gefesselt. Die EU ist kein geopolitischer Akteur im klassischen Sinn, weil sie von innen heraus widersprüchlich gebaut ist. Ihre wirtschaftliche Rationalität würde sie zu Verständigung, Stabilität und Kooperation drängen; ihre sicherheitspolitische Realität bindet sie an die amerikanische Linie. Es ist kein Geheimnis, dass Europa in diesem Konflikt der große Verlierer ist. Doch ebenso ist klar, dass es über keine Instrumente verfügt, um gegen die strategische Gravitation seiner Schutzmacht anzusteuern. Friedensappelle sind in diesem Rahmen rhetorische Figuren ohne operative Bedeutung.
Ein ähnliches Verhängnis findet sich im Nahen Osten, doch mit weit mehr zerklüfteten Ebenen. Dort überlagern sich regionale Rivalitäten – Iran gegen Saudi-Arabien, Israel gegen seine Nachbarn, die Türkei mit hegemonialen Ambitionen – mit den Interessen der äußeren Großmächte. Die USA sichern nach wie vor Seewege und Energieflüsse und verhindern durch ihre Präsenz eine völlige Neuordnung der Region. China dringt in die wirtschaftlichen Strukturen ein, Russland behauptet Stützpunkte in Syrien. Die Region ist kein zufällig instabiler Raum; sie ist ein Knotenpunkt, an dem sich Energiepreise, religiöse Konflikte, strategische Projektionen und externe Hegemonialsphären überlagern. Ein vollkommen stabiler Naher Osten wäre für mehrere dieser Akteure sogar ungünstig: Er würde die geopolitische Notwendigkeit von Schutz, Vermittlung und Präsenz reduzieren und damit Machtmittel entwerten. Instabilität ist hier weniger ein Unglück als ein struktureller Nebeneffekt.
So ergibt sich ein Gesamtbild, das ernüchternd wirkt: Die beiden sichtbarsten Konflikträume unserer Gegenwart, Ukraine und Nahost, sind nicht deshalb so hartnäckig, weil die beteiligten Mächte unfähig oder unwillig wären, sondern weil ein Gleichgewicht, das allen nützen würde, momentan nicht existiert. Jeder Frieden, der erreichbar scheint, würde die Machtposition irgendeines zentralen Akteurs verschlechtern. Ein solcher Frieden hat deshalb keine treibenden Kräfte. Russland fürchtet Einkreisung, die Vereinigten Staaten fürchten eurasische Integration, Europa fürchtet den Verlust der eigenen wirtschaftlichen Basis, China möchte Zeit gewinnen und seine Lieferwege sichern, und die Nahoststaaten fürchten, dass Stabilität die tektonischen Spannungen ihrer Systeme offenlegen könnte.
Was bleibt, ist das Bild einer Weltordnung, die in Übergang geraten ist. Die alten Sicherheiten erodieren schneller, als neue entstehen können. Die Konflikte sind Ausdruck dieses Übergangs, nicht seine Ursache. Frieden wird erst dann möglich sein, wenn ein neues Gleichgewicht sichtbar wird – eines, das die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt, die ökonomische Notwendigkeit Europas, die hegemonialen Ambitionen der USA, die Entwicklungschancen Chinas und die inneren Bruchlinien des Nahen Ostens. Solange dieses Gleichgewicht nicht erkennbar ist, bleiben die Konflikte bestehen: nicht als zufällige Tragödien, sondern als Strukturphänomene einer Epoche, die den alten Rahmen sprengt, ohne bereits einen neuen gefunden zu haben.
Quellen
Halford J. Mackinder: The Geographical Pivot of History (1904).
Halford J. Mackinder: Democratic Ideals and Reality (1919).
Nicholas J. Spykman: America’s Strategy in World Politics (1942).
Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard (1997).
U.S. National Security Strategy (verschiedene Ausgaben 1991–2022).
U.S. National Defense Strategy (Pentagon, 2018–2023).
Russische Militärdoktrin, Ausgaben 2014 und 2021.
Timothy Snyder: The Road to Unfreedom (2018).
Lawrence Freedman: Ukraine and the Art of Strategy (2019).
John J. Mearsheimer: The Tragedy of Great Power Politics (2001/2014).

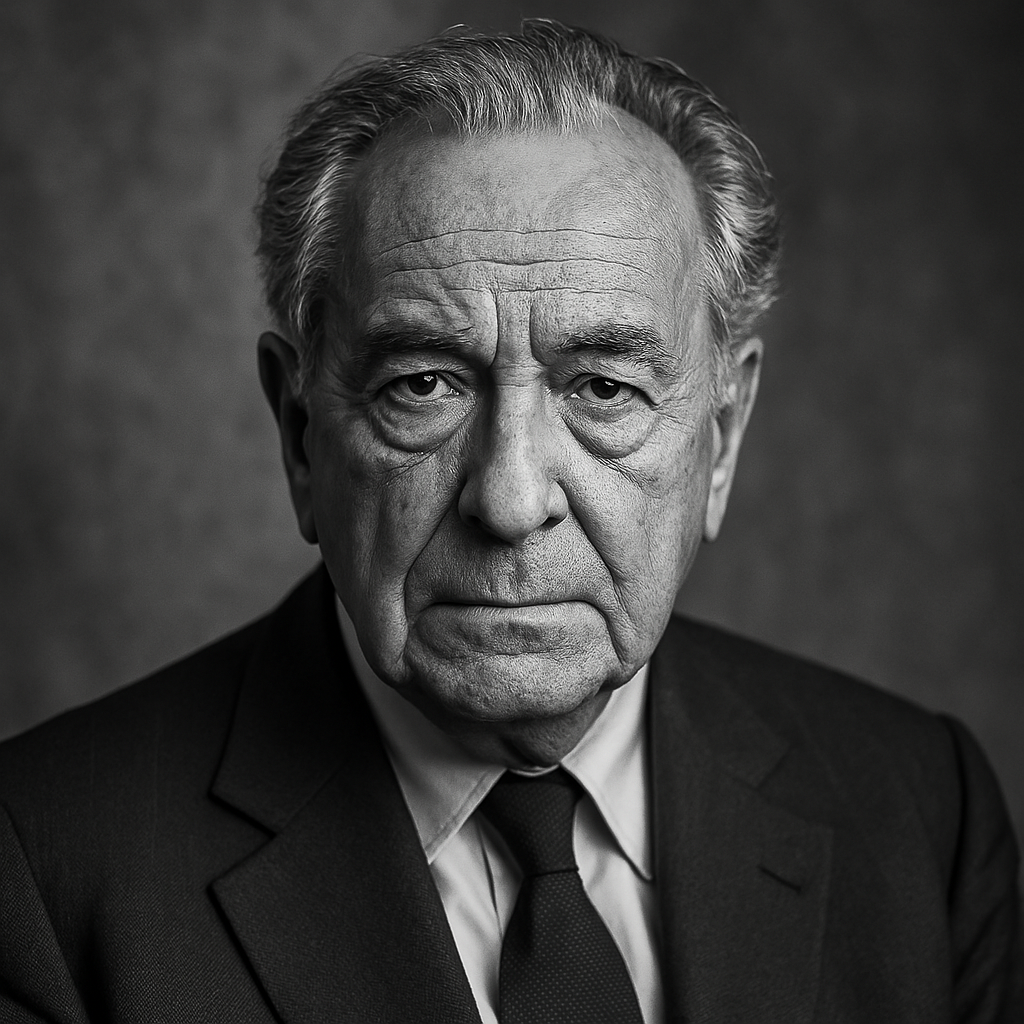


 Le JOUR POLITIQUE
Le JOUR POLITIQUE © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche





















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.