![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Elisabeth von Lorraine‑Vaudémont (Elisabeth von Lothringen).
Die Erfindung des Prosaromans an der Saar.

✍️ Solène M’Bali
Solène M’Bali sammelt Fragmente wie andere Muscheln. Wörter, Bilder, Verschwundenes. Was andere übersehen, wird für sie zum Anfang einer Geschichte.. Ihre Recherche ist kein Zugriff, sondern ein Lauschen. Solène bewegt sich lautlos durch Archive, durch digitale Schatten, durch Fußnoten, die zu Welten werden. Sie ist die Stimme der Vergessenen, eine Chronistin der verschütteten Geschichten. Geboren unter dem Vulkan von La Réunion, aufgewachsen zwischen Zuckerrohrfeldern und den Wellen des Indischen Ozeans. Was sie schreibt, hat Gewicht – nicht, weil es laut ist, sondern weil es bleibt. Sie glaubt an Erinnerung als Widerstand – und daran, dass jede Akte, jedes Foto, jeder Satz eine letzte Patrone sein kann.
🗓️ Veröffentlichung: 26. Juli 2025
📰 Medium: La Dernière Cartouche
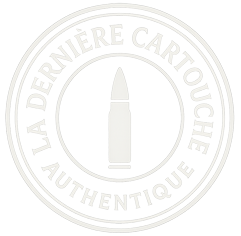

Erzählt von Solène M’Bali – aus Fragmenten, Handschriften und Steinen zu einer Geschichte verwoben.
 An den Ufern der Saar, wo sich Sprachen und Geschichten begegnen, fand ein neues Erzählen seinen Anfang. In Saarbrücken, im Schatten von Burgen und auf den Wegen der Händler, entstanden deutsche Worte für französische Rittergeschichten – und aus dieser Arbeit wuchs eine Form, die Literatur veränderte.
An den Ufern der Saar, wo sich Sprachen und Geschichten begegnen, fand ein neues Erzählen seinen Anfang. In Saarbrücken, im Schatten von Burgen und auf den Wegen der Händler, entstanden deutsche Worte für französische Rittergeschichten – und aus dieser Arbeit wuchs eine Form, die Literatur veränderte.
Elisabeth von Lorraine‑Vaudémont wurde um 1395 in Lothringen geboren. Sie wuchs in einer Welt auf, in der höfische Lieder gesungen wurden, französische Chroniken vorgelesen und politische Ehen geschlossen. Französisch und Deutsch flossen in ihrem Alltag zusammen wie zwei Wasserläufe, die sich in einem Tal begegnen. Schon als Kind lernte sie, dass diese Doppelsprachigkeit keine Last war, sondern ein Vermögen: Sie öffnete Türen, sie verband Welten.
1412 heiratete sie Philipp von Nassau‑Saarbrücken. Mit dieser Ehe verknüpfte sich ihr lothringisches Erbe mit einem Gebiet, das von Blies und Saar bis an den Rhein reichte. Die Landschaft, in der sie nun lebte, war geprägt von Burgen auf Hügeln, Märkten an Flussübergängen und einem ständigen Ringen um Macht. Elisabeth brachte nicht nur ihren Namen mit, sondern eine Bildung, die tief in der französischen Kultur wurzelte, und eine Fähigkeit, zwischen Höfen und Sprachen zu vermitteln.
Die Jahre an der Seite ihres Mannes waren Jahre des Lernens. Sie bewegte sich in einem Geflecht aus Titeln, Ansprüchen und Bündnissen, beobachtete die Balance zwischen Nähe und Distanz, die jedes Fürstenhaus verlangte. Dann kam der Winter 1429, und mit ihm der Tod Philipps. In Saarbrücken erloschen Kerzen, und die Zukunft wurde schwer. Zwei Söhne waren zu jung, um zu regieren, und eine Grafschaft wartete auf Führung.
Elisabeth übernahm die Regentschaft. Saarbrücken wurde unter ihr zum Mittelpunkt der Grafschaft. Sie ordnete Kanzlei und Schatzamt, führte die verstreuten Landstriche zu einer handlungsfähigen Einheit. Ihr Stil war still, aber fest. Sie führte durch Schreiben, durch Verhandeln, durch die Sorgfalt, Streit zu vermeiden, bevor er zu Blut führte.
Neben der Arbeit des Regierens trug sie eine zweite Welt in sich: die Geschichten. Seit ihrer Kindheit waren die französischen Ritterromane Teil ihres Denkens. In Saarbrücken griff sie sie auf. Unter ihrem Auftrag entstanden vier große Übersetzungen: Herpin, Sibille, Loher und Maller und Huge Scheppel.
Diese Arbeit füllte die gleichen Kanzleien, in denen auch Urkunden geschrieben wurden. Elisabeth diktierte, korrigierte, lenkte. Aus französischen Versen wurde deutsche Prosa. Es war ein sprachlicher und zugleich kultureller Schritt.
Spätere Gelehrte nennen diese Werke den Anfang des deutschen Prosaromans. Vorher gab es Erzählungen in Prosa, doch hier, unter Elisabeths Namen, wurde eine Form sichtbar, die Bestand hatte. In den Vorreden der Handschriften erscheint ihr Name – eine seltene Anerkennung für eine Frau des 15. Jahrhunderts. Sie war nicht nur Auftraggeberin. Sie war die geistige Kraft hinter dem Werk.
Ein Name in einer Vorrede, ein Pergament in Wolfenbüttel, eine Grabplatte in St. Arnual: aus diesen Fragmenten wächst ein Bild. Es zeigt eine Frau, die regierte und schrieb, die Land hielt und Sprache formte. Die Romane, die unter ihrer Leitung entstanden, trugen Helden, Königinnen, Intrigen und Prüfungen zu einem neuen Publikum.
Elisabeth ließ diese Texte umformen, weil sie wusste, dass Geschichten nur dann überleben, wenn sie in den Worten derer erzählt werden, die sie hören. Unter ihren Händen verließen die Ritterepen den engen Kreis höfischer Unterhaltung und wurden Teil einer deutschen Erzähltradition.

Während die Pergamente gefüllt wurden, blieb die Regentschaft ihr tägliches Werk. Sie verhandelte mit Trier, mit Lothringen, mit Nachbarn, deren Stimmen fordernd waren. Sie regierte mit Beharrlichkeit. Saarbrücken blieb unter ihrer Aufsicht eine Insel der Ordnung.
Ihr Wirken verband zwei Räume. Ihre Herkunft war lothringisch, ihr Handeln saarländisch. Sie brachte die französische Bildung mit, aber sie verankerte sie an der Saar. Aus dieser Verbindung entstand eine Literatur, die Grenzen überschritt.
Die Spuren ihrer Arbeit reichen bis heute. Drei Bände ihres Sohnes Johann liegen in Wolfenbüttel und Hamburg. Huge Scheppel erschien 1500 in Straßburg im Druck und trug noch ihren Namen in der Widmung. Über Jahrhunderte hielten ihre Übersetzungen Bedeutung, lange nachdem die Stimmen an den Höfen verstummt waren.
1456 starb Elisabeth. Sie wählte St. Arnual in Saarbrücken als ihre letzte Ruhestätte. Dort liegt sie, und ein Stein trägt ihren Namen.
An der Saar nahm der Prosaroman Gestalt an, weil Elisabeth von Lorraine‑Vaudémont Worte in Bewegung setzte. Ihre Herkunft und ihr Wirken verbanden Lothringen und das Saarland – und aus dieser Verbindung wuchs ein Stück europäischer Kulturgeschichte, das bis heute weiterwirkt.
Quellenangaben
Primäre Biografiedaten und historische Kontexte
– Elisabeth von Lothringen, Gräfin von Nassau-Saarbrücken. Wikipedia (deutsch, englisch, französisch), Stand Juli 2025.
– Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestände zur Grafschaft Nassau-Saarbrücken.
Regentschaft und politische Rolle
– Schwinges, Rainer C.: Frauen in der europäischen Stadt des Mittelalters. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1995, S. 201–203.
– Brück, Anton: Geschichte der Grafschaft Saarbrücken. Saarbrücken 1983.
Übersetzungen und literarische Bedeutung
– Brinker-von der Heyde, Claudia: Übersetzen im Spätmittelalter – Französische höfische Literatur und ihre Übertragung ins Deutsche. Reichert Verlag, Wiesbaden 2010.
– Artikel „Elisabeth von Nassau-Saarbrücken“ im Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters, 2. Auflage, Bd. 2, Sp. 273–280.
Prosaroman und Gattungsfrage
– Eis, Gerhard: Der deutsche Prosaroman des Mittelalters. Hirzel, Stuttgart 1963.
– Bluhm, Lothar: „Elisabeth von Nassau-Saarbrücken und die Prosaübertragungen französischer Epen.“ In: Zeitschrift für deutsche Philologie 124 (2005).
Handschriften & Nachleben
– Handschriftenkataloge der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Cod. Guelf. 18.2 Aug. 2° u. a.).
– Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Handschriftensammlung: Bände aus dem Nachlass Johann III. von Nassau-Saarbrücken.
– Behr, Hans-Joachim: Die Handschriften Elisabeths von Nassau-Saarbrücken. Hamburg 1987.
Rezeption & Ausstellung
– Ir herren machent fryden – Elisabeth von Nassau-Saarbrücken und ihre Welt. Ausstellungskatalog Historisches Museum Saar, Saarbrücken 2007.
– Jacobs, Ulrike & Jacobs, Manfred: Die Grenzgängerin. Elisabeth von Lothringen. Romanbiografie, Saarbrücken 2007.





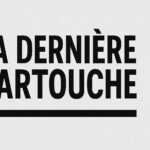 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS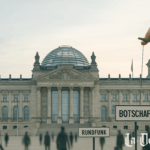 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.