![]()
Zwischen Shitstorm und Schweigen – Der Kollaps der Medien Ein Essay von Étienne Valbreton
Die Gegenwart steht im Zeichen einer Überfülle an Stimmen, die einander überlagern, bis keine mehr unterscheidbar bleibt. Was als Rede erscheint, ist oft nur Echo – ein Flirren von Lauten, die sich selbst genügen. Worte kreisen. Bewegung ohne Richtung, Klang ohne Grund. Die Sprache ist nicht mehr Ort der Erkenntnis, sondern Mittel des Verschwindens. Der Mensch spricht, um nicht zu verstummen – und verliert gerade darin das Maß seiner Stimme.
In dieser Überfülle löst sich Bedeutung auf. Was sich Öffentlichkeit nennt, ist ein Kreislauf aus Reaktion und Spiegelung. Die Rede hat ihren Gegenstand verloren, die Empörung hat ihn ersetzt. Jede Meinung sucht nicht nach Wahrheit, sondern nach Wirkung. Das Gespräch, einst Ort der Begegnung, ist zum Kampfplatz der Aufmerksamkeit geworden. Der Satz ist keine Brücke mehr, sondern ein Pfeil – und manchmal trifft er ins Leere.
Der sogenannte Shitstorm ist die sichtbarste Form dieser Umkehrung. Ein Moment kollektiver Erregung, in dem Moral und Mechanik sich vereinen. Niemand lenkt ihn, niemand entzieht sich ihm. Er entsteht aus der Summe der Reaktionen, die sich gegenseitig verstärken, bis sie in Erschöpfung münden. Denken hält darin nicht stand, weil es Zeit braucht. Und Zeit ist das Einzige, was in der digitalen Welt nicht vorhanden ist.
Die alten Denker kannten das Gewicht der Stille. Sie wussten, dass Wahrheit nicht im Lärm geboren wird. Platon verlangte das Gespräch im Schatten, fern vom Markt. Augustinus sprach vom inneren Wort, das gehört werden will, bevor es ausgesprochen wird. Heute dagegen entsteht Sinn nur noch in der Öffentlichkeit, die keine Tiefe mehr hat. Die digitale Agora kennt keine Stille; sie verwechselt Wahrheit mit Reichweite.
Die Medien sind nicht Opfer, sondern Teil dieser Logik. Sie folgen dem Rhythmus der Empörung, weil dieser Rhythmus Quote bringt. Sie verwechseln Bewegung mit Leben. Der Journalismus, einst Gedächtnis der Gesellschaft, verwandelt sich in ein Gedächtnis ohne Dauer. Die Nachricht ersetzt den Zusammenhang. Der Kommentar – das Urteil. Was gestern aufgedeckt wurde, ist heute vergessen, bevor es verstanden werden konnte.
Der Preis ist hoch. Mit der Erschöpfung der Medien schwindet das Vertrauen in die Wirklichkeit selbst. Wenn jede Darstellung nur eine Haltung ist, verliert die Wahrheit ihren Ort. Nietzsche ahnte diesen Moment, als er vom Tod Gottes sprach. Nicht die Religion verschwand, sondern die Gewissheit, dass es etwas Gemeinsames gibt, das alle Rede trägt. Der heutige Verlust betrifft nicht den Glauben, sondern die Evidenz. Wir wissen nicht mehr, was wir wissen dürfen.
In dieser Unsicherheit gedeiht die Empörung. Sie ersetzt das Denken durch Gewissheit, das Gespräch durch Urteil. Der Shitstorm ist das Tribunal der Gegenwart. Ein Ritual ohne Richter, aber mit Strafe. Camus hätte darin das Abbild einer Gesellschaft erkannt, die das Maß verloren hat. Arendt hätte gesagt, dass sie das Urteilen mit Moral verwechselt. Beides führt zur gleichen Stille: Niemand wagt mehr, etwas zu sagen, was nicht schon vorher gebilligt ist.
Die Intellektuellen reagieren mit Rückzug. Manche schweigen, weil sie das Geschrei nicht mehr ertragen, andere, weil sie wissen, dass jedes Wort gegen sie verwendet wird. Schweigen, das einst Form des Nachdenkens war, wird zur Schutzmaßnahme. Wer spricht, wird vereinfacht. Wer schweigt, verschwindet. Beides tötet das Denken. So entsteht eine neue Form von Einsamkeit: die derjenigen, die noch denken, aber keinen Ort mehr finden, es auszusprechen.
Diese Angst vor dem Wort verändert die Sprache selbst. Sätze werden glatt, Begriffe vorsichtig, Gedanken entschärft. Die Menschen sprechen in Signalen. Sie sagen weniger, als sie andeuten. Vielleicht, weil sie gelernt haben, dass Klarheit gefährlich ist. Das Gespräch wird zur Chiffre, zur Kunst des Ausweichens. In Universitäten, Redaktionen, Theatern entstehen Räume der stillen Selbstzensur. Man nickt, um zu überleben. Das Denken verliert seine Reibung.
Foucault hätte in dieser Entwicklung nicht nur einen kulturellen, sondern einen politischen Prozess gesehen. Macht äußert sich nicht mehr durch Zwang, sondern durch Zustimmung. Das Subjekt formt sich nach der Erwartung. Der Diskurs regiert, indem er die Grenzen dessen bestimmt, was sagbar ist. Der Shitstorm ist die sichtbare Seite dieser unsichtbaren Disziplinierung.
Auch Heidegger würde diesen Zustand erkennen. In seiner Sprache hieße er das Gerede – jenes flüchtige Sprechen, das sich selbst genügt. Wo alles gesagt wird, bleibt nichts gesagt. Wahrheit wird nicht mehr entborgen, sie wird verteilt. Das Dasein verliert die Nähe zum Sein, weil es in der Öffentlichkeit seiner selbst zerstreut ist.
Und doch ist dies nicht bloß Philosophie. Man kann sie sehen, hören, spüren. In den Redaktionen, die die eigenen Schlagzeilen fürchten. In den Universitäten, in denen Meinungsfreiheit ein theoretischer Begriff geworden ist. In der Kunst, die sich moralisch rechtfertigen muss, bevor sie beginnt. Die Kultur des Verdachts ersetzt die Kultur des Vertrauens. Der öffentliche Raum wird zur Bühne der Selbstrechtfertigung.
Dabei war Sprache immer ein Ort der Freiheit. Sie erlaubte, das Unsagbare zu umkreisen, ohne es zu verraten. Der Satz war Bewegung, nicht Etikett. Heute aber ist er Schranke geworden – nicht aus Stein, sondern aus Zustimmung. Roland Barthes schrieb, dass Macht dort beginnt, wo Bedeutung erstarrt. Die Medienwelt hat diese Erstarrung perfektioniert. Sie produziert Zeichen, die nichts mehr bezeichnen.
Die Folge ist ein neuer Analphabetismus. Menschen lesen unaufhörlich, aber sie verstehen nicht mehr, was sie aufnehmen. Information ersetzt Erkenntnis. Die Welt wird konsumiert, nicht befragt. Benjamin sah im 20. Jahrhundert den Verlust der Erfahrung. Im 21. vollendet sich dieser Verlust. Erfahrung wird ersetzt durch das Ereignis, das sofort verschwindet.
Doch inmitten dieser Bewegung bleibt eine leise Möglichkeit. Der Kollaps der Medien ist nicht nur Untergang, sondern Symptom. Er zeigt, dass der Mensch nach einem neuen Verhältnis zur Wahrheit sucht. Wenn das Wort wieder Gewicht gewinnen soll, muss es dem Schweigen entstammen. Der Dialog muss langsamer werden als die Nachricht.
Vielleicht beginnt eine neue Öffentlichkeit dort, wo jemand zuhört, bevor er antwortet. Ein Gespräch, das nicht auf Zustimmung zielt, sondern auf Verstehen, könnte das Gegengift sein. Arendt nannte das Denken ein stilles Gespräch der Seele mit sich selbst. Diese innere Öffentlichkeit ist der einzige Ort, an dem Freiheit entstehen kann.
Das Schweigen ist kein Rückzug, sondern Wiederaneignung der Sprache. Es ist die Weigerung, Teil einer Industrie der Empörung zu sein. Es ist der Versuch, das Wort zurückzuführen zu dem, was es einmal war: Werkzeug des Sinns, nicht der Zustimmung.
Der Zusammenbruch der Medien ist also weniger Katastrophe als Offenbarung. Er zeigt, wie verletzlich die Wahrheit ist, wenn sie ökonomisch vermittelt wird. Er erinnert daran, dass Denken nur dort überlebt, wo man es nicht verkauft. Vielleicht ist das die stille Aufgabe unserer Zeit: das Schweigen so zu bewahren, dass das Wort wieder entstehen kann.
Die Gesellschaft, die das begreift, wird nicht stiller, sondern klarer. Sie wird nicht weniger reden, sondern bewusster sprechen. Zwischen Shitstorm und Schweigen liegt ein Raum, der weder Empörung noch Angst kennt – die Sprache selbst.
Wenn die Welt eines Tages wieder zuhört, wird sie erkennen, dass der Lärm, der sie beherrschte, nichts anderes war als Angst vor dem Denken. Und dass die Wahrheit nie verschwunden war, sondern nur gewartet hat, bis man ihr wieder zuhört.
Literaturempfehlungen
Nietzsche, Heidegger, Arendt, Benjamin, Rosa, Handke:
Diese Autoren beleuchten Themen wie Sprache als Macht, die Zerstreuung im digitalen Zeitalter, die Funktion von Rede und Schweigen, die Bedingungen von Freiheit und dialogischer Existenz sowie Resonanz und den Wert stillen Nachdenkens – alles zentrale Motive im Essay.
Foucault, Barthes, Camus, Baudrillard, Stiegler, Weil:
Hier geht es um Machtstrukturen im Diskurs, die Mythen der modernen Gesellschaft, die ethischen Paradoxien der Gegenwart, die Rolle der Simulation in Medien und Technologie sowie um Schweigen als geistige Haltung.
Deutsche Denktradition
Friedrich Nietzsche – Jenseits von Gut und Böse
Moral als Maskierung der Macht, Sprache als Wille zur Form.
Walter Benjamin – Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
Über die Zerstreuung der Wahrnehmung im medialen Zeitalter.
Martin Heidegger – Sein und Zeit (§35 „Das Gerede“)
Analyse des leeren Sprechens als Verlust der Nähe zum Sein.
Hannah Arendt – Vita activa oder Vom tätigen Leben
Sprechen als Form politischer Existenz, Freiheit im Dialog.
Hartmut Rosa – Resonanz
Vom Verstummen der Welt und dem Bedürfnis nach Beziehung.
Peter Handke – Versuch über den Stillen Ort
Sprache als Zuflucht des Denkens im Rückzug.
Französische Denktradition
Michel Foucault – L’ordre du discours
Über Macht, Wahrheit und die Grenzen des Sagbaren.
Roland Barthes – Mythologies
Die Sprache der Gesellschaft als System ideologischer Zeichen.
Albert Camus – L’Homme révolté
Die Ethik des Maßes im Zeitalter der moralischen Überhitzung.
Jean Baudrillard – Simulacres et Simulation
Über den Verlust der Realität im Zeichen des Medialen.
Bernard Stiegler – La société automatique
Technologie als neue Struktur des Bewusstseins.
Simone Weil – La Pesanteur et la grâce
Das Schweigen als Form geistiger Wahrheit.




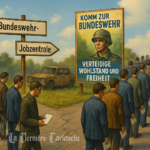 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche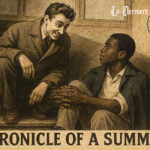 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 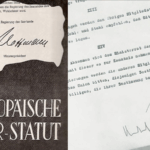 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.