![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Pont-à-Mousson, Erinnerung und die Ästhetik des Verschweigens
Les Combattantes – Pont-à-Mousson, Erinnerung und die Ästhetik des Verschweigens
ein Essay von Jack O’Reilly
Wenn man den Bildschirm ausschaltet, bleibt für einen Moment das Nachbild: eine Frau in Nonnenkleidung, Blut an den Händen, im Hintergrund die Vogesen im Dunst. Es ist ein schöner, fast zu schöner Anblick. Les Combattantes erzählt vom September 1914, vom Chaos der ersten Kriegsmonate, von vier Frauen, die inmitten des Zusammenbruchs ihre Würde bewahren. Doch was die Serie zeigt, ist nicht der Krieg, sondern sein Abglanz – gefiltert durch Licht, Kostüm und Dekor. Der Grand Est, der hier den Schauplatz bildet, ist kein Ort mehr, sondern eine Kulisse.
Ich kenne diese Landschaft. Zwischen Pont-à-Mousson und Saint-Mihiel zieht sich die Mosel in engen Schleifen durch das Hügelland. Der Bois-le-Prêtre, ein unscheinbarer Forst oberhalb von Montauville, ist heute ein stiller Ort, fast vergessen. Zwischen 1914 und 1915 starben hier über zwanzigtausend Männer – Franzosen und Deutsche –, oft nur wenige Meter voneinander entfernt. Ihre Gräben, ihre Unterstände, ihre Schreie sind längst von Gras überwachsen. Die Serie nennt diesen Ort, doch sie zeigt ihn nicht. Sie spricht von der Front, aber sie vermeidet das Schlammige, das Ungeordnete, das Unbeschreibliche.
I. Saint-Paulin – der erfundene Ort
Die Geschichte spielt in einem fiktiven Dorf namens Saint-Paulin. Es liegt irgendwo in den Vogesen, unweit der Frontlinie. Eine junge Krankenschwester aus Paris, Suzanne, flieht vor der Justiz, weil sie Abtreibungen vorgenommen hat. Zufällig findet sie Zuflucht in einem Kloster, das inzwischen als Militärlazarett dient. Dort begegnet sie der Oberin Mère Agnès, der Industriellengattin Caroline, die die Waffenfabrik ihres Mannes übernehmen muss, und Marguerite, einer Prostituierten, die aus anderen Gründen an die Front gekommen ist. Vier Frauen, vier Wege, vier Formen von Widerstand.
Das ist die Stärke der Serie: Sie erzählt den Krieg von innen, aus dem weiblichen Raum heraus. Aber der Ort, an dem sie das tut, ist eine Konstruktion. Gedreht wurde in Bains-les-Bains, in der Abbaye de Valloires in der Picardie und in der Chartreuse de Neuville, also weit entfernt vom eigentlichen Frontgebiet. Man hat dort Straßen mit Erde bedeckt, moderne Schilder abmontiert, Fenster zugemauert – die Kulisse nachgebildet, aber den Ort ersetzt.
Es ist kein Zufall, dass Les Combattantes den Grand Est zwar behauptet, aber nicht zeigt. Zu groß wäre die Last der Geschichte, zu widersprüchlich die Landschaft. Zwischen Metz, Nancy und Verdun liegt das Gedächtnis Europas, dicht, unaufgeräumt, unbequem. Man kann dort keinen schönen Krieg drehen.
II. Gedrehte Landschaften
Die Produktion war gewaltig: über hundertfünfzig Sprechrollen, dreitausend Statisten, Pferde, Lastwagen, Kanonen, Uniformen. Der Regisseur Alexandre Laurent hat aus der Region ein Tableau geschaffen, das an die Malerei des 19. Jahrhunderts erinnert – Lichtnebel, klare Linien, eine Komposition, die mehr mit Gérôme oder Detaille zu tun hat als mit dem Krieg von 1914. Der Wald ist nie grau, das Blut nie schwarz, der Himmel nie zerrissen.
Man muss das nicht moralisch sehen. Vielleicht braucht Fernsehen diese Ästhetik, um überhaupt noch erzählen zu können. Doch sie hat Folgen. Wo der Schlamm war, ist jetzt Leinenstoff. Wo der Lärm tobte, spielt Musik. Die Frontlinie wird zum moralischen Experiment, nicht mehr zum Ort des Tötens.
Dabei war der Grand Est keine Abstraktion. Der Krieg dort war total. Pont-à-Mousson wurde zu 80 Prozent zerstört, die Abtei der Prämonstratenser brannte aus, Saint-Mihiel blieb vier Jahre lang besetzt, der Bois-le-Prêtre war ein permanentes Massengrab. In Les Combattantes ist davon kaum etwas zu spüren. Es gibt keine Ruinen, keine Versehrten, keine Toten ohne Gesicht. Der Krieg bleibt sauber.
III. Die Nonnen – Hüterinnen der Schwelle
Das Kloster ist das Zentrum der Serie. Mère Agnès, gespielt von Sandrine Bonnaire, steht zwischen Gehorsam und Menschlichkeit. Die Nonnen waschen Wunden, beten, zweifeln. Man könnte meinen, hier öffnet sich eine neue Perspektive: Frauen, die den Krieg nicht führen, sondern heilen. Doch auch dieser Raum ist stilisiert.
Die historischen Vorbilder waren anders. In Pont-à-Mousson, Nancy und Verdun arbeiteten Hunderte von Ordensfrauen in improvisierten Hospitälern – oft unter französischem und deutschem Feuer, ohne Schutz, ohne Pause. Die Archive nennen die Schwestern vom Heiligen Karl von Nancy, die Vinzentinerinnen, die Barmherzigen von Metz. Sie versorgten Männer mit zerfetzten Gesichtern, Amputierte, Gasopfer. In ihren Berichten liest man nichts von romantischer Zuwendung. Nur Disziplin, Erschöpfung und Glauben.
In Les Combattantes wird dieses Leiden abstrahiert. Das Kloster wird zum Symbol: ein Ort, an dem die alte Ordnung zerbricht. Die Kamera bewegt sich langsam, das Licht fällt wie durch Buntglas. Der Schmerz wird schön, beinahe kontemplativ.
IV. Das Schweigen über Lothringen
Was auffällt, ist nicht, was gezeigt wird, sondern was fehlt. Die Serie spielt in Lothringen, aber sie spricht nie von Lothringen. Kein Wort über die jahrzehntelange Zerrissenheit der Region zwischen Frankreich und Deutschland, kein Akzent, kein zweisprachiges Schild, kein Hinweis auf die politische und kulturelle Ambivalenz dieser Gegend.
Dabei war gerade das der Kern des Krieges hier: dass die Menschen beides waren – französisch und deutsch, katholisch und republikanisch, Arbeiter und Bauern, Gläubige und Skeptiker. Der Krieg in Lothringen war ein Bürgerkrieg im europäischen Maßstab. Doch Les Combattantes überspringt diesen Abgrund. Der Feind bleibt gesichtslos, das Andere abstrakt.
Man kann das als narrative Entscheidung lesen: Der Fokus liegt auf den Frauen, nicht auf den Frontverläufen. Aber das Schweigen hat Folgen. Es löscht die regionale Identität aus. Der Grand Est wird auf eine Textur reduziert – Nebel, Wälder, Dörfer. Die Geschichte, die dort wirklich geschah, bleibt ungesagt.
V. Der schöne Krieg
Les Combattantes ist ein Meisterwerk der Ausstattung. Uniformen, Pferdegeschirre, Lampen, Patronengurte – alles makellos. Selbst der Schmutz wirkt arrangiert. Die Musik trägt die Szenen wie eine Messe. Es ist, als sei das Unzeigbare in Stil gegossen worden.
Das ist gefährlich und faszinierend zugleich. Frankreich hat eine lange Tradition, den Krieg in Schönheit zu verwandeln: von David über Delacroix bis Malraux. Immer bleibt der heroische Blick, selbst im Leid. Les Combattantes setzt diese Linie fort – nur dass der Heroismus nun weiblich ist.
Doch Schönheit hat einen Preis. Wo der Schmerz formvollendet wird, verliert er seine Wucht. Die Verwundeten in der Serie sterben würdevoll, nicht verstümmelt. Die Nonnen sind rein, nicht verschmutzt. Der Krieg riecht nicht. Alles bleibt erträglich.
Man kann das als Trost begreifen – oder als Verdrängung. Die Serie zeigt nicht den Horror, sondern das Bedürfnis, ihn zu bändigen.
VI. Nachhall
Ich war im vergangenen Sommer wieder in Pont-à-Mousson. Auf dem alten Soldatenfriedhof, zwischen den Reihen der weißen Kreuze, wächst Gras bis an die Inschriften. Vom Bois-le-Prêtre her weht Wind. In der Ferne läutet eine Glocke.
Dort, wo die Serie ihren erfundenen Ort Saint-Paulin ansiedelt, gibt es in Wahrheit nichts als Stille. Und doch ist diese Stille sprechender als jedes Bild. Der Grand Est ist kein dekorativer Hintergrund, sondern ein Körper aus Erinnerung. Man muss ihn hören können, um ihn zu verstehen.
Les Combattantes erzählt einen Krieg, der sich in Gesichtern spiegelt. Aber sie erzählt ihn, als sei er vergangen. Dabei ist er, in dieser Landschaft, nie ganz vorbei. Vielleicht liegt darin die eigentliche Tragik: dass Erinnerung erst dann wieder sichtbar wird, wenn man sie filmreif gemacht hat.
Pont-à-Mousson, Saint-Mihiel, Bois-le-Prêtre – sie alle haben überlebt, weil niemand mehr hinsieht. Und vielleicht ist das der blinde Fleck, den die Serie ungewollt offenlegt: dass Geschichte nur dann wiederkehrt, wenn sie sich als Dekor tarnt.
TOPOGRAPHISCHES
Karte der Erinnerungsorte des Ersten Weltkriegs
Raum Pont-à-Mousson (Grand Est)
Erläuterung
Diese interaktive Karte zeigt die wichtigsten Erinnerungsorte des Frontbogens von Saint-Mihiel zwischen Verdun und Pont-à-Mousson. Sie macht den realen Schauplatz sichtbar, auf den sich die Serie Les Combattantes bezieht, und ermöglicht es, ihren topographischen und historischen Spuren zu folgen.
| Ort / Stätte | Typ / Charakter | Entfernung zu Pont-à-Mousson | Historischer Kontext | Bezug zu Les Combattantes |
|---|---|---|---|---|
| Nécropole nationale du Pétant (Pont-à-Mousson) | Soldatenfriedhof (≈ 1 400 Gräber) | — (innerhalb der Stadt) | Gefallene von 1914–18; erste Frontphase an der Mosel | Entspricht dem fiktiven Hintergrund der „Frontnähe“; Beispiel für reale Kriegsopfer der Region |
| Abbaye des Prémontrés (Pont-à-Mousson) | Ehemaliges Kloster, Lazarett 1914–18 | — | Historischer Schauplatz geistlicher Krankenpflege | Reale Entsprechung des Filmklosters „Saint-Paulin“ |
| Monument du Bois-le-Prêtre (Montauville) | Denkmal / Mahnmal | ca. 5 km SW | Ort heftigster Kämpfe 1914–15; über 20 000 Tote | Realer topographischer Bezug der Serienhandlung („Waldfront“) |
| Ossuaire du Bois-le-Prêtre | Beinhaus / Gedenkstätte | ca. 5 km SW | Unbekannte Gefallene; Symbol kollektiver Opfer | Verdeutlicht, was die Serie ästhetisch ausblendet |
| Fort de Liouville (Apremont-la-Forêt) | Festungswerk / Fort Séré de Rivières | ca. 8 km S | Teil des Verteidigungsriegels der Hauts de Meuse, stark bombardiert ab 1914 | Spiegelt das militärische Umfeld, das im Film nur angedeutet ist |
| Musée 14–18 de Marbotte (Apremont-la-Forêt) | Museum / Ausstellung | ca. 8 km S | Fotografien, Uniformen und Alltagsgegenstände aus dem Ersten Weltkrieg | Ergänzt die militärische Perspektive um zivile Zeugnisse der Frontregion |
| Saint-Mihiel – Nécropole nationale | Nationalfriedhof (≈ 10 000 Gräber) | ca. 25 km S | Zentrum der deutschen Besatzung 1914–18 | Geografisches Echo der Serienfront |
| Exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel (Saint-Mihiel) | Historische Ausstellung / Dokumentationszentrum | ca. 25 km S | Dokumente und Objekte zu den Kämpfen im Saint-Mihiel-Bogen (1914–18) | Ergänzt die in der Serie fehlende historische Tiefenschicht |
| Musée de la Baïonnette (Regniéville) | Museum / Sammlung 14–18 | ca. 30 km SW | Errichtet auf dem Gelände ehemaliger Schützengräben; gewidmet den Kämpfen bei Regniéville | Verleiht dem Krieg ein materielles Gesicht, das der Film abstrahiert |
| Tranchée de la Soif (Ailly-sur-Meuse, Bois d’Ailly) | Restaurierter Frontabschnitt / Lehrpfad | ca. 20 km S | Ehemalige französische Stellung im Bois d’Ailly südlich des Saint-Mihiel-Bogens | Zeigt das, was Les Combattantes vermeidet: Schlamm, Lärm, Tod |
| Église Saint-Laurent (Montauville) | Pfarrkirche / Denkmaltafeln | ca. 5 km SW | Gedenktafeln des 166. Infanterieregiments | Ort lebendiger lokaler Erinnerung |
| Route de la Mémoire 14–18 (Verdun–Saint-Mihiel–Pont-à-Mousson) | Themenroute / Kulturweg | — (Region Grand Est) | Vernetzung der wichtigsten Gedenkorte entlang des ehemaligen Frontbogens | Eröffnet die Möglichkeit einer dokumentarischen Vertiefung über die Serie hinaus |
Korrekturen vorgenommen auf Hinweis einer Leserin (Oktober 2025).

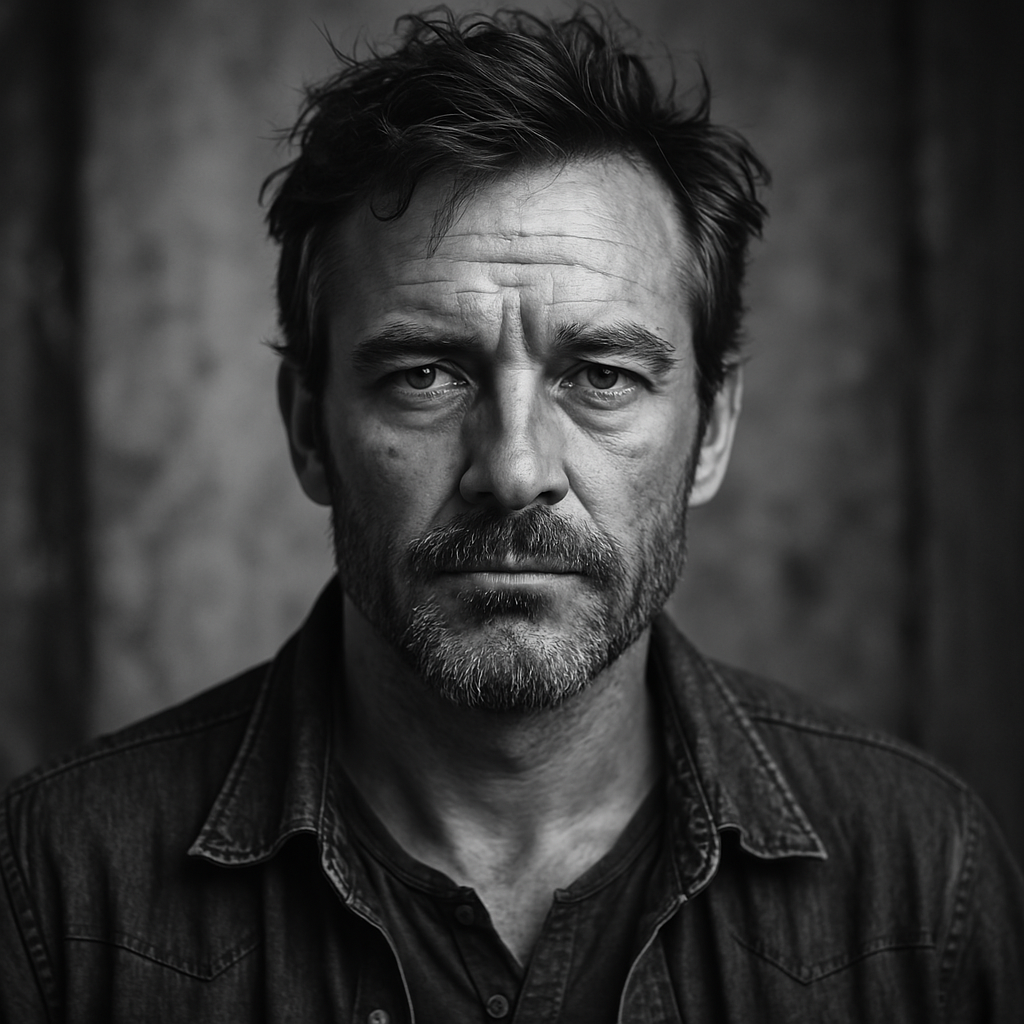


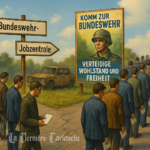 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS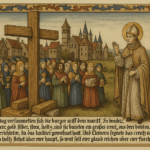
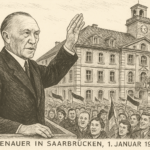























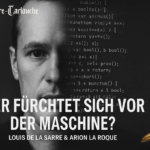 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.