![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Die Welt betrachten
Jean Rouch und die bewegliche Wahrheit
Redaktioneller Hinweis
Jean Rouch – Ethnologe, Regisseur, Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Poesie.
Er beobachtete Afrika mit der Kamera, doch je länger er filmte, desto mehr verschwand die Trennlinie zwischen dem Beobachteten und dem Beobachter. Seine Methode, das „cinéma vérité“, war kein Versuch, eine objektive Wahrheit zu fixieren, sondern der Versuch, sie im Augenblick ihrer Bewegung zu erfassen.
Clémence Moreau stellt die zentrale Frage: Was geschieht, wenn die Kamera zu einem moralischen Akteur wird? Und: Kann man einen Menschen filmen, ohne ihn zu besitzen? Dabei will sie nicht erklären, sondern Ordnung in eine Welt bringen, die zu viel erklärt. Denn für sie ist Schreiben kein Ausdruck von Meinung, sondern von Haltung. Und Haltung entsteht aus Selbstbegrenzung.
Jean Rouch und die bewegliche Wahrheit
(Ein Essay von Clémence Moreau)
Am Ufer des Niger, 1946, verliert Jean Rouch sein Stativ. Das Wasser verschluckt das Metall, als wollte es einen letzten Rest Stabilität aus der Welt der Beobachtung ziehen. Rouch hält die Kamera fest, aber ohne Auflage, ohne Halt. Von da an muss er sie führen wie ein Organ, das reagiert, nicht dominiert. Es ist eine Geburtsstunde des modernen Dokumentarfilms¹, und zugleich sein Abschied von der Vorstellung, dass man eine Wahrheit festhalten könne, indem man sie ruhigstellt.
Rouch war kein Cineast im üblichen Sinn, er war Ingenieur und Ethnologe². Ein Mann, der auf Expedition ging, bevor er zum Stil kam. Er war Schüler von Marcel Mauss³, und Mauss hatte gelehrt, dass jede Geste ein sozialer Akt ist, ein kleiner Vertrag zwischen dem Ich und dem Anderen. Rouch übertrug diesen Gedanken auf das Bild. Die Kamera war für ihn kein Auge der Wissenschaft, sondern ein Teil dieses Vertrags. Sie sollte weder verstecken noch enthüllen, sondern teilnehmen.
Wenn er begann, in Westafrika zu filmen, war der ethnografische Film ein Instrument des Beweises⁴. Man filmte, um zu klassifizieren, um zu benennen, um zu zeigen, was „die anderen“ tun. Die Kamera stand still, weil man glaubte, das Wissen brauche Distanz. Rouch aber ahnte, dass Distanz selbst eine Form der Lüge sein kann. Er ging näher heran, und mit jedem Schritt verlor er Autorität.
In seinen frühen Filmen, etwa Les Maîtres Fous (1954), wird diese Nähe zum Experiment⁵. Rouch filmt ein Ritual der Hauka in Ghana, bei dem die Teilnehmer in Trance fallen und die Gestalten der Kolonialherren annehmen: den Gouverneur, den Offizier, den Ingenieur. Sie parodieren die Macht, bis das Parodierte selbst in Ekstase vergeht. Der Westen, der glaubte, andere zu betrachten, sieht plötzlich sich selbst – als Karikatur, als Dämon, als Spiegel.
Dieser Film war ein Schock⁶. Er wurde in Europa teils verboten, teils bestaunt, teils als Unverschämtheit empfunden. Die Linke warf Rouch vor, er romantisiere die Unterdrückten; die Rechte, er beleidige die Zivilisation. Er stand zwischen beiden, allein. Doch sein Anliegen war weder Provokation noch Verteidigung. Er wollte verstehen, wie Menschen unter der Last der Geschichte Rituale erfinden, um sie zu tragen. Die Trance war für ihn kein Spektakel, sondern eine Sprache⁷.
Ousmane Sembène, der große senegalesische Regisseur, warf ihm später vor: „Du schaust uns an wie Insekten.“⁸ Dieser Satz ist grausam, aber er hat recht behalten, weil er das moralische Problem benennt, das alle Ethnografie verfolgt: der Blick, der glaubt, sich selbst ausschließen zu können. Rouch antwortete nicht mit Worten, sondern mit Arbeit. Er filmte weiter, aber anders – in Bewegung, im Dialog, im Risiko.
Sein Film Jaguar, begonnen 1957 und erst zehn Jahre später vollendet, zeigt drei junge Männer, die von Niger nach Ghana reisen, um Arbeit zu finden⁹. Der Film ist Beobachtung und Fiktion zugleich. Rouch dreht die Bilder, aber erst später, im Schneideraum, sprechen die Männer über das, was sie sehen. Sie kommentieren ihre eigene Darstellung, lachen, widersprechen. Der Film wird zu einem Ort geteilter Autorschaft. Nichts bleibt fixiert.
Rouch nannte diese Methode cine-trance¹⁰. Damit meinte er nicht Rausch, sondern Übergang. Die Kamera, sagte er, müsse selbst in einen Zustand geraten, in dem sie nicht mehr bloß registriert, sondern mitschwingt. Der Filmemacher wird Teil des Rituals, ohne es zu besitzen. Diese Haltung ist radikal und gefährlich zugleich: Sie fordert Nähe, wo Wissenschaft Distanz verlangt, und sie verlangt Moral, wo Kunst nach Freiheit ruft.
In Chronique d’un été (1961), gemeinsam mit Edgar Morin gedreht, findet dieses Prinzip seine französische Form¹¹. Der Film beginnt mit einer einfachen Frage an Passanten in Paris: „Êtes-vous heureux?“ – „Sind Sie glücklich?“ Eine triviale Frage, die doch alles öffnet. Die Kamera begleitet Menschen, die sich auf der Straße, zu Hause, in Gesprächen zeigen. Kein Kommentar, keine Musik, keine Dramaturgie. Nur Zeit, Atem, Zögern.
Rouch und Morin wollten wissen, ob man Wahrheit filmen kann¹². Am Ende mussten sie zugeben, dass man es nicht kann – und dass genau darin der Sinn liegt. Die Wahrheit entzieht sich, sobald sie gesucht wird. Sie lebt nur in der Bewegung, im Zwischenraum von Rede und Schweigen, im Moment des Blicks. Chronique d’un été endet mit der Ernüchterung seiner eigenen Methode: Die Gefilmten sehen ihre Szenen und sagen, sie erkennen sich nicht wieder. Das Kino zeigt nicht, wie die Dinge sind, sondern wie sie sich verändern, wenn man sie betrachtet.
Diese Einsicht ist keine ästhetische, sondern eine moralische¹³. Sie betrifft die Haltung des Filmenden gegenüber dem, was er zeigt. Jean Rouch wusste, dass man Wahrheit nicht besitzen darf, wenn man sie nicht zerstören will. Das unterscheidet ihn von den vielen, die heute Authentizität reklamieren, als wäre sie ein Stilmittel. Rouchs Kino hat keine Botschaft, nur eine Haltung: Geduld, Achtung, Aufmerksamkeit.
In den Filmen, die er mit Germaine Dieterlen über die Dogon in Mali drehte, wird diese Haltung sichtbar wie ein Gebet¹⁴. Über Jahrzehnte, zwischen 1950 und 1974, beobachteten sie Rituale, Zeremonien, den Lauf des Sigi-Festes. Keine Musik, keine Kommentare. Nur langsame, fast demütige Bilder, die sich der Dauer des Wirklichen anpassen. Man kann diese Filme langweilig finden, wenn man Fernsehen gewohnt ist. Oder man kann sie als das sehen, was sie sind: eine Ethik der Wahrnehmung.
Für Rouch war die Kamera kein Auge, sondern eine Stimme¹⁵. Sie spricht, indem sie schweigt. Sie richtet sich nicht über das, was sie sieht, sondern begleitet es. Das unterscheidet ihn von der britischen Schule des „observational cinema“ und von der amerikanischen Direktheit der siebziger Jahre. Sein Blick ist französisch, das heißt: nicht neutral, sondern zivilisiert.
Fußnoten
1. Paul Henley, The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema, Chicago / London 2010, S. 21–23.
2. Eva Hohenberger, Die Wirklichkeit des Films: Dokumentarfilm, ethnographischer Film, Jean Rouch, Hildesheim 1988, S. 45.
3. Marcel Mauss, Soziologie und Anthropologie, Frankfurt a. M. 1978 (Orig. 1950), S. 22 ff.
4. Henley 2010, S. 55 f.
5. Jean Rouch, Les Maîtres Fous [Film], Frankreich 1954.
6. Julian Vigo, „Power/Knowledge and Discourse: Turning the Ethnographic Gaze Around in Jean Rouch’s Chronique d’un Été“, in: Visual Sociology, 1995, S. 16.
7. Hohenberger 1988, S. 72 ff.
8. Ousmane Sembène, zitiert nach Jeff Himpele / Faye Ginsburg, „Ciné-Trance: A Tribute to Jean Rouch (1917–2004)“, in: American Anthropologist 107 (2005), S. 108.
9. Henley 2010, S. 134 f.
10. Paul Stoller, The Cinematic Griot: The Ethnography of Jean Rouch, Chicago / London 1992, S. 11 ff.
11. Rouch / Morin, Chronique d’un été [Film], Frankreich 1961.
12. Henley 2010, S. 203.
13. Hohenberger 1988, S. 119.
14. WDR-Reihe Rituale der Dogon, Deutschland 1998 (Neufassung 2000).
15. Stoller 1992, S. 98 f.
16. Hohenberger 1988, S. 152.
17. Henley 2010, S. 312.
18. Berlinale-Archiv, Jean Rouch – Le rêve plus fort que la mort, Festival Programm 2002.
19. Paul Stoller, „Jean Rouch’s Legacy“, in: Anthropology Today, Bd. 21 (2005), S. 23.
Literaturverzeichnis (alphabetisch)
Berlinale-Archiv: Jean Rouch – Le rêve plus fort que la mort. Festivalprogramm 2002.
Henley, Paul: The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema. University of Chicago Press, Chicago / London 2010.
Himpele, Jeff / Ginsburg, Faye: „Ciné-Trance: A Tribute to Jean Rouch (1917–2004)“. In: American Anthropologist 107 (2005), S. 108–128.
Hohenberger, Eva: Die Wirklichkeit des Films: Dokumentarfilm, ethnographischer Film, Jean Rouch. Olms, Hildesheim 1988.
Mauss, Marcel: Soziologie und Anthropologie. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1978 (Orig. 1950).
Rouch, Jean / Morin, Edgar: Chronique d’un été [Film]. Frankreich 1961.
Rouch, Jean: Les Maîtres Fous [Film]. Frankreich 1954.
Stoller, Paul: The Cinematic Griot. The Ethnography of Jean Rouch. University of Chicago Press, Chicago / London 1992.
Stoller, Paul: „Jean Rouch’s Legacy“. In: Anthropology Today, Bd. 21 (2005), S. 22–25.
Vigo, Julian: „Power/Knowledge and Discourse: Turning the Ethnographic Gaze Around in Jean Rouch’s Chronique d’un Été“. In: Visual Sociology 1995, S. 14–38.
WDR: Rituale der Dogon. Fernsehreihe, Deutschland 1998 / 2000.
„Ich glaube nicht, dass es eine Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst gibt. Alle Spielfilme, die ich gemacht habe, hatten immer dasselbe Thema – die Entdeckung des Anderen, eine Erforschung der Verschiedenheit.“
Aus der Zusammenarbeit zwischen einem Anthropologen und einem Soziologen entwickelt sich eine aufschlussreiche, reflexive Studie über menschliches Verhalten. Dieser Dokumentarfilm ist ein einflussreicher Klassiker des Cinéma Vérité – dessen Name von Co-Regisseur Edgar Morin sogar geprägt wurde!
Der Trailer stammt von mubi.com



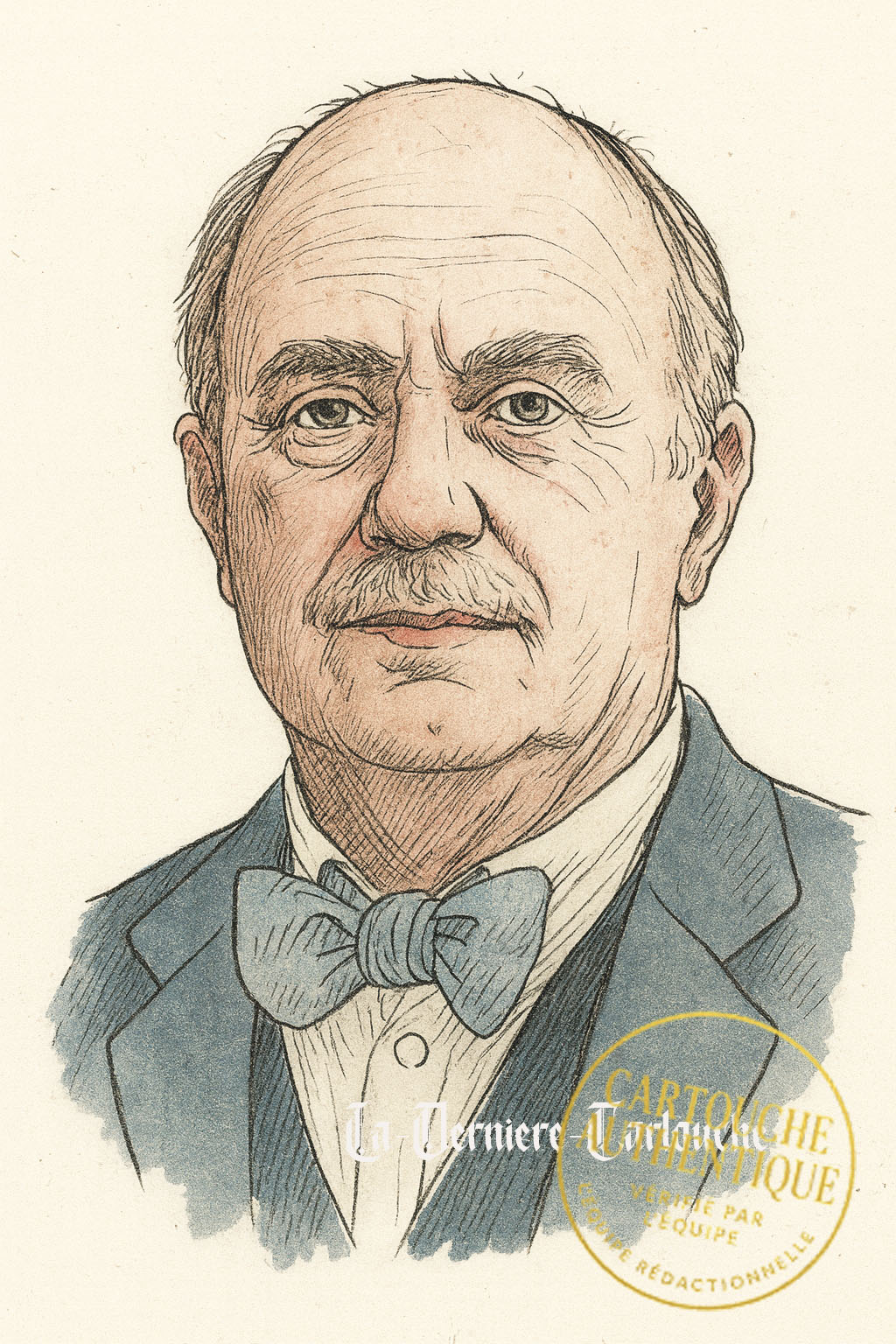

 Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Markus Lüpertz Porträtkarikatur Public domain
Public domain
 public domain
public domain 






















 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.