![]()
(Französische Übersetzung in Arbeit) | 9992 |17448
Bowie, Gorman, Wahl: Über Kunst, Freiheit, Denkblasen
Eine Glosse
Anmerkung
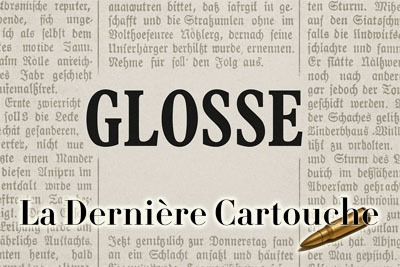
In diesem Text geht es um Vorstellungskraft und Freiheit. Er wurde ohne Beihilfe elektronisch erzeugter Fähigkeiten geschrieben und ist Ergebnis der Arbeit eines neuronalen Netzes mit eigenen, persönlichen Grenzen und dem Streben nach Erkenntnisgewinn. Im Sinne des Denkers Karls Jaspers liegt Freiheit in der Debatte. Diese Freiheit zum Streit möchte ich beim genannten Thema nicht noch durch künstliche Filter beeinflussen lassen, und meinen Gedanken zur Grundlage weiterer Diskussionen machen, sofern diese Gedanken es verdienen.
Ich bespreche drei bekannte, sogar berühmte Personen mit ihren eigenen Arbeiten und Ansätzen und stelle dabei die Frage, was die drei trennt oder verbindet, wenn wir über die Kritik an ihrer Arbeit sprechen.
er für seinen stetigen Wandel berüchtigte britische Sänger, Maler, Autor, Schauspieler und Komponist David Bowie (1947 – 2016), der es geschafft hat, die eigene Auflösung mit seiner Kunst zu verbinden (Blackstar, 2016) wurde oft und falsch wegen seines stetigen Wandels als Chamäleon bezeichnet. Ein Chamäleon aber wandelt sich zur Tarnung. Bowie wollte mit seiner unbändigen Kreativität auffallen. Dies sei aber nur am Rande und als schroffes Beispiel für eine fehlerhafte Sicht einer Künstlerpersönlichkeit bemerkt.
Amanda Gorman (geboren 1998) ist eine US-amerikanische Schriftstellerin und Lyrikerin, die an der Einführungszeremonie für Joe Biden vortragend teilnahm und im Anschluss mit ihrem (in viele Sprachen übersetzten) Gedicht The Hill we Climb weltweit bekannt wurde.
Caroline Wahl (geboren1995) ist Germanistin und erfolgreiche deutsche Schriftstellerin (22 Bahnen, Windstärke 17, Die Assistentin), eine Autorin die sich, wie alle öffentlichen Personen, teils erheblich guter wie natürlich auch schlechter Kritik stellen muss. Auf die Einzelheiten ihrer literarischen Arbeiten gehe ich aus Gründen der thematischen Scharfstellung hier nicht ein.
Beginnen wir also, und dies mit der negativen Kritik an Gorman. Hier geht es nicht um die Bekrittelung ihrer Texte im eigentlichen Sinne, sondern um den Umgang mit ihren Übersetzerinnen und Übersetzern. Erste Arbeiten aus Katalonien, den Niederlanden und Deutschland wurden zum Gegenstand heftiger Kontroversen, da manche nicht glauben und akzeptieren wollten, dass Personen anderen Geschlechts oder anderer Hautfarbe als die Dichterin selbst die persönliche Haltung Gormans in der fremdsprachlichen Übertragung widerspiegeln oder nachfühlen könnten. So wurde geschrieben, nur weibliche Personen mit dem Hintergrund POC wären in der Lage, Gormans Erfahrungen nachzuvollziehen. Andere Übersetzungsversuche seien zu verwerfen.
Bei Wahl ging ein erheblicher Teil der Kritik in die folgende Richtung: Eine privilegierte Autorin wie Wahl (Vater Chirurg, Mutter Lehrerin) könne keinesfalls wie die Protagonistin Ida (in 22 Bahnen) Prekariat und Armut schildern, weil sie selbst diese Umstände ja nie am eigenen Leibe erfahren habe. Gedanken an Èdouard Louis drängen sich hier auf.
Beide Ansätze der Kritik zeigen keinerlei Wissen um und Gespür für Kunst. Richtiger wäre es sogar, von einem Abgrund an Unwissen oder gar bodenloser Beschränktheit zu sprechen: Nicht umsonst gilt immer noch das Bonmot vom Kopf, der rund ist, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Was denn sind Kunst und Literatur? Sind es nicht die Künstlerinnen und Künstler, die uns mit ihrer unfassbaren Vorstellungskraft an ferne Ufer und auf ferne Planeten entführen und uns damit so viel an Erfüllung geben? Um ein paar banale Beispiele zu nehmen: Können Leif Randt und Asimov nicht zu fernen Zeiten und Universen führen, ohne jemals dort gewesen zu sein? Konnte May über indigene Völker schreiben, ohne sie je besucht zu haben? Kann Nachtwey als Wissenschaftler zum rechten Rand forschen, ohne ihm anzugehören? Durfte Flaubert (Salammbô) über ferne Zeiten in Karthago fantasieren, ohne sie erlebt zu haben? Kann Hanks den Vietnamkrieg darstellen, wenn er gar nicht an ihm teilgenommen hat? Konnte, in anderer Denkweise, nur ein Fallada über Morphinsucht schreiben? Und durfte Frank Zappa über Billy the Mountain singen, ohne jemals Felsen gewesen zu sein?
In meinem Gespür (ich lese viel und gerne) schreibt Wahl unfassbar gut und glaubhaft über Armut. Wir brauchen solche Schriftstellerinnen, die sich diesem wichtigen Thema annehmen, ohne das die politisch extremen Verwerfungen unserer Zeit gar nicht erklärbar wären. Ohne solche Erklärer blieben viele ahnungslos. Sie bekämen niemals einen Einblick in fremde Lebenssituationen. Bei Caroline Wahl erinnere ich mich an den Russenturm, die Bezeichnung für ein Hochhaus voller Spätaussiedler. In meiner Gegend gibt’s nämlich auch im Volksmund Wodkahäuser, keine zehn Minuten sind sie entfernt. Man muss darüber und ihre Bewohner schreiben. Die Menschen darin verdienen es. Und: Man darf sich von der Meute rein gar nichts verbieten lassen. Nach Jaspers wäre eine solche Haltung die Unterordnung unter eine denkerische oder religiöse Diktatur. Sind Übersetzerinnen denkbar, die mit umfassendem Wissen Texte erschließen, um sie in die jeweilige Muttersprache zu übertragen? Leute, die die Fähigkeiten ihrer schaffende Mitmenschen unterschätzen, zeigen damit lediglich ihre eigenen Beschränkungen auf. Im Umkehrschluss hieße die Haltung der Blase mit ihren Reiz-Reaktions-Meachnismen: Wahl soll Arztromene schreiben und über privilegierte Kuüchentische schreiben, Übersetzerinnen und Übersetzer sollten lediglich Texte übertragen, die Produkte ihrer eigenen Ethnien sind.
Kommen wir auf Bowie, den Thin White Duke, den Starman, Harlekin, Major Tom und schwarzen Stern, zu dem er nun geworden ist: Ashes to Ashes. Nach meiner Kenntnis hat sich Bowie niemals in einer Raumkapsel aufgehalten. Und hat dennoch in seinem bekanntesten Lied (Space Oddity) über jemanden gesungen, der im Weltraum verloren geht. Da brauchen wir von Life on Mars oder auch Fall Dog Bombs the Moon gar nicht erst zu reden. Warum aber darf Bowie das und die anderen nicht? Warum ist hier gar nichts zu hören? Hat man ihn nicht richtig verstanden? Ist er nicht gegenwärtig genug? Liegt es daran, dass er der der Vergangenheit entstammt? Inkludiert das Blasendenken nicht jede mögliche Überlegung und entlarvt sich so als nicht stringent?
Zum Schluss noch ein Wort zum bedeutenden Philosophen und Psychiater Jaspers (1883 – 1969), der nicht nur im hiesigen Zusammenhang wieder hochaktuell geworden ist. Für ihn sind Fortschritt und sinnvolles Leben, wenn ich ihn richtig verstanden habe, nur in einer völlig freien Debatte möglich. Tun wir alles dafür, dass vielschichtige Streitkultur in Zeiten der Stadtbilder (Merz) und der blasenhaften, erfahrungsfreien, undurchdachten Kritik an diesem Bild wieder Fahrt aufnehmen kann. Unsere ausnehmend schwierige Zeit hat es verdient.
Christof Sperl
Dipl.-Romanist/ Anglist
Deutscher Frankoromanistenverband – FRV/AFRA
www.francoromanistes.de | smartstorys.at
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!



 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.)
© La Dernière Cartouche – Tous droits réservés. (Création originale. Utilisation strictement réservée à l'identité visuelle du magazine.) Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Markus Lüpertz Porträtkarikatur Public domain
Public domain

























Herr Sperl, Sie haben recht – und das ist heute fast ein Skandal.
Ihr Text ist ein Affront gegen das neue Pflichtgefühl, das Denken an Identität zu koppeln. Sie sagen, Kunst sei Vorstellungskraft, nicht Herkunft. Punkt. In einer Zeit, in der man schon um Erlaubnis bitten muss, um über etwas zu schreiben, das man nicht selbst erlebt hat, klingt das wie Blasphemie.
Die Hüter der Empfindlichkeit werden Ihnen vorwerfen, Sie seien unsensibel. Ich nenne es: wach. Sie erinnern daran, dass Freiheit auch bedeutet, sich irren zu dürfen – und dass Kunst nicht der verlängerte Arm moralischer Pädagogik ist.
Bleiben Sie unbequem, Herr Sperl. Die Welt braucht weniger Betroffenheit und mehr Verstand.
Ein schöner Kommentar. Vielleicht ist Wachheit dort versteckt, wo man sie nicht vermutet.