![]()
Vom Ideal des Gewaltverzichts zur Moral der Wehrhaftigkeit
Die theologische Zeitenwende: Wie die katholische Kirche in Deutschland den Pazifismus aufgegeben hat
Vom Ideal des Gewaltverzichts zur Moral der Wehrhaftigkeit
Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil galt die katholische Kirche in Deutschland als moralische Stimme des Pazifismus. Ihre Haltung gründete auf der Überzeugung, dass Gewalt, wenn überhaupt, nur als äußerstes Mittel denkbar sei. Die Denkschrift Gerechtigkeit schafft Frieden von 1983 machte dies zur kirchlichen Norm¹. Frieden war nicht das Resultat militärischer Stärke, sondern Ausdruck von Vertrauen, Gewissen und Verzicht.
Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 fiel diese Gewissheit in sich zusammen. Die Deutsche Bischofskonferenz erklärte, die militärische Verteidigungsfähigkeit sei aus friedensethischer Sicht legitim². Was nach pragmatischer Anpassung klang, war eine theologische Wende. Der Pazifismus, über Jahrzehnte Teil des kirchlichen Selbstverständnisses, wurde zur historischen Denkform erklärt, überholt von einer Ethik, die Wehrhaftigkeit als neue Tugend begreift.
Dieser Bruch kam nicht plötzlich. Nach den humanitären Katastrophen der 1990er Jahre – Bosnien, Ruanda – begann die kirchliche Friedenslehre, den reinen Pazifismus zu prüfen. Die Schrift Gerechter Friede (2000) führte die Idee der „Schutzverantwortung“ ein: Staaten hätten nicht nur das Recht, sondern eine Pflicht, Unrecht zu verhindern – notfalls mit militärischen Mitteln³. Der Krieg in der Ukraine machte daraus ein Gebot. Die Kirche sprach vom Recht auf Selbstverteidigung, ja von einer Pflicht dazu. Der Vorrang des Gewaltverzichts wich einer Pflicht zum Widerstand. Frieden, so lautete fortan die neue Logik, entsteht nicht mehr durch Abrüstung, sondern durch Abschreckung.
Auffällig ist, wie sehr sich diese Sprache in den letzten Jahren derjenigen der Politik angenähert hat. Begriffe wie Zeitenwende, Verantwortung, Wehrhaftigkeit finden sich heute in kirchlichen Stellungnahmen mit großer Selbstverständlichkeit⁴. Während die Kirche in den 1980er Jahren eine kritische Kraft gegenüber der NATO-Strategie war, tritt sie heute als moralische Stütze einer sicherheitspolitischen Ordnung auf. Sie segnet, was sie einst mahnte. So stellt sich die Frage, ob hier Erkenntnis spricht oder Anpassung an den Zeitgeist, der den moralischen Anspruch durch Notwendigkeit ersetzt. Wo Glaubenssprache und Machtanspruch verschmelzen, wird das Denken stumpf.
Inhaltlich knüpft diese Wende an die alte Lehre vom bellum iustum an, an das augustinische Modell des gerechten Krieges. Augustinus betrachtete Krieg als tragische Konsequenz menschlicher Schuld in einer gefallenen Welt – Gewalt war nie gut, sie konnte nur das geringere Übel sein⁵. Die heutige Friedensethik verschiebt diesen Akzent: Sie begreift Verteidigung nicht als moralischen Konflikt, sondern als Pflicht zur Ordnung. Das Gewissen, das früher zwischen Gehorsam und Schuld abwog, wird nun selbst zum Instrument der Legitimationsrhetorik. Wer kämpft, handelt verantwortungsvoll; wer zweifelt, gefährdet den Frieden.
Hinter dieser Verschiebung steht ein tiefes Bedürfnis nach Entlastung. Der Pazifismus der Nachkriegszeit war moralisches Erbe der Schuld, die kaum zu tragen war. „Nie wieder“ war nicht nur politisches Programm, sondern Bekenntnis zu einer anderen Anthropologie: der Mensch als fehlbares Wesen, das Gewalt in sich trägt und ihr nur durch Verzicht entkommt. Diese Sprache war schwer, doch sie bewahrte das Gewissen. Die neue Ethik befreit vom Gewicht des Schuldbewusstseins. Sie ersetzt Demut durch Verantwortungsrhetorik. Wer verteidigt, darf sich gut fühlen. Wer Waffen liefert, kann sich gerecht nennen. So wandelt sich das moralische Dilemma zur Gewissensruhe. Frieden, einst aus dem Verzicht geboren, wird nun aus der Fortsetzung des Handelns abgeleitet.
Der Begriff Zeitenwende, von der Politik geprägt, erhält eine zweite, tiefere Bedeutung. Er meint nicht nur politische Zäsur, sondern Verschiebung der moralischen Koordinaten. Aus einer Lehre des Verzichts wird eine Lehre der Notwendigkeit, aus einer Ethik der Schuld eine Ethik des Gewissens. Die Kirche hat ihre Nachkriegsethik hinter sich gelassen und sich der Welt angeschlossen, die sie einst zu mahnen versuchte. Ob das ein Zeichen von Klarheit ist oder ein Eingeständnis von Ohnmacht – bleibt offen. Sicher ist nur: Diese Zeitenwende ist nicht politisch, sondern theologisch – und sie verändert, was die Kirche künftig über Schuld, Verantwortung und Frieden zu sagen haben wird.



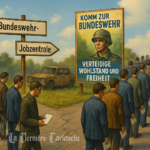 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche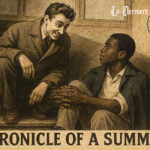 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 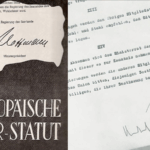 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière  © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS





















 Public domain
Public domain Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Markus Lüpertz Porträtkarikatur
Quellenangaben
Fußnoten
Offizielles Friedenswort über Frieden, Gerechtigkeit und Gewaltverzicht.
www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/deutsche-bischoefe/DB48.pdf
Seit 2022 fortlaufend aktualisierte thematische Erklärungen und Friedensappelle.
www.dbk.de/themen/krieg-in-der-ukraine
Grundlagendokument der kirchlichen Friedensethik mit Einführung des Konzepts der Schutzverantwortung.
www.dbk-shop.de/media/files_public/…/DBK_1166.pdf
Thematisiert die Rolle der Wehrfähigkeit und die Neubewertung der Verteidigungsethik.
upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/…/DBK2024Friedwrt-11113.pdf
Überblick zur historischen und theologischen Entwicklung des bellum iustum in der katholischen Friedenslehre.
www.gemeinschaft-katholischer-soldaten.de/themen/friedensethik