![]()
Cet article est disponible en : 🇫🇷 Français
Wie ich lernte, die Windmühlen zu lieben
Don Quijote zwischen Wahn, Wahrheit und Würde
Viele von uns sind Don Quijote schon als Kinder begegnet – in Schulausgaben, als illustrierte Abenteuer, vielleicht auch im Kino. Man erinnert sich an die große Verfilmung mit Sophia Loren, die in den 1970er-Jahren die Kinos füllte. Aber ebenso an eine andere, die in Deutschland fast vergessen ist: den vierteiligen Schwarz-Weiß-Fernsehfilm Don Quijote von der Mancha von 1965. Eine deutsch-französische Koproduktion, ausgestrahlt im ZDF, mit Josef Meinrad als Don Quijote und Roger Carel als Sancho Panza. Gerade diese Fassung ist mehr als nur ein Fernsehabenteuer der sechziger Jahre. Sie zeigt, wie sehr Cervantes’ Roman immer schon europäisch gedacht werden musste: als gemeinsames kulturelles Erbe, das nicht an Landesgrenzen haltmacht.
Und hier liegt auch der Bogen zu La Dernière Cartouche. Wir lesen und deuten den Don Quijote nicht nur als spanisches Werk, sondern als europäisches, das zwischen Spanien, Frankreich und Deutschland wirkt und neu interpretiert wird. Vielleicht haben viele von uns den Ritter von der traurigen Gestalt als Kinder gesehen. Die eigentliche Frage lautet aber: Haben wir ihn als Erwachsene noch einmal gelesen?
Wie ich lernte, die Windmühlen zu lieben
Es beginnt mit einem Buch, das einen alten Mann in den Wahnsinn treibt, oder vielleicht in eine seltsame Klarheit. Alonso Quijano, ein verarmter Landedelmann, liest so viele Ritterromane, bis er eines Morgens erwacht und beschließt, selbst zum Ritter zu werden. Er rüstet sich mit einer rostigen Rüstung, tauft sein mageres Pferd zum edlen Ross und zieht aus, um Unrecht zu bekämpfen. Die Nachbarn lachen. Sein Knappe Sancho Panza, ein bäuerlicher Realist, lacht ebenfalls, während er seinem Herrn nachtrottet und dabei an seinen Esel, an Wein und an ein warmes Bett denkt. Auch der Leser lacht zunächst. Wie könnte man nicht lachen über diesen grotesken Kontrast zwischen grandiosen Träumen und armseliger Wirklichkeit? Doch dann passiert etwas Seltsames: Das Lachen verstummt allmählich, Seite für Seite. Denn Don Quijote, dieser vermeintliche Narr, stellt eine Frage, die uns alle angeht: Was wäre, wenn die Welt nicht so sein müsste, wie sie ist? Was wäre, wenn wir die Dinge nicht nehmen müssten, wie sie erscheinen, sondern wie sie sein könnten?
Die erste große Szene ist bekannt: Don Quijote sieht in den Windmühlen bedrohliche Riesen, die es zu bekämpfen gilt. Er stürmt vorwärts, die Lanze im Anschlag, und wird von den rotierenden Flügeln zurückgeschleudert, zerschunden, gedemütigt. Sancho, der nüchterne Beobachter, seufzt nur, und Don Quijote besteht darauf, dass er Riesen sieht. Hier, in diesem scheinbar absurden Moment, liegt der erste Schlüssel zum Verständnis. Die Windmühlen sind nicht einfach nur Mühlen. Sie verkörpern den Widerstand der Welt gegen das Ideal¹, sie stehen für alles, was wir als unveränderlich hinnehmen, für die Trägheit der Gesellschaft, die Macht der Gewohnheit, die Schwerkraft des So-ist-das-nun-einmal. Don Quijote greift sie an, nicht weil er blind wäre, sondern weil er sich weigert, das Gegebene einfach hinzunehmen. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob er recht hat, sondern ob er recht haben sollte.
Sancho Panza, dieser bodenständige Knappe, der an praktische Dinge denkt, an Essen, an seinen Esel, an die kleine Insel, die ihm versprochen wurde, lacht zunächst über seinen Herrn. Er korrigiert ihn, hält ihn für verrückt, für einen alten Narren, der die Realität aus den Augen verloren hat. Je länger er ihm folgt, desto mehr gerät auch er in den Bann der Träume. In einer berühmten Szene beginnt Sancho plötzlich, von dieser Insel zu träumen, nicht mehr als Witz, sondern als echte Möglichkeit. Die Idee hat ihn angesteckt². Sie überzeugt nicht durch Beweise, sondern weckt ein Begehren, das vorher fehlte. Es wirkt, als kämpfe Don Quijote nicht nur gegen Windmühlen, sondern auch gegen die Mauern in Sanchos eigener Vorstellungskraft.
Nirgends wird dies deutlicher als in der Szene mit Dulcinea. Don Quijote braucht eine Dame, der er dienen kann, ein Ideal, für das er leben und kämpfen kann. Er wählt eine einfache Bäuerin namens Aldonza Lorenzo und erhebt sie in seiner Fantasie zur Prinzessin Dulcinea del Toboso. Für alle anderen bleibt sie, was sie ist, eine derbe Landarbeiterin. Für Don Quijote wird sie zur Verkörperung aller Schönheit und Tugend. Hier zeigt sich seine radikale Geste: Würde ist keine Eigenschaft, sondern eine Zuschreibung³. Ein Mensch wird zur Dame, weil jemand ihn als Dame behandelt. Das ist als Fakt eine Unwahrheit und zugleich als Sinn eine tiefere Wahrheit. Don Quijote sieht in Aldonza nicht, was sie ist, sondern was sie sein könnte. Diese Logik greift in gegenwärtigen Debatten über soziale Gerechtigkeit und Identität, in denen Anerkennung nicht bloß festgestellt, sondern performativ hergestellt wird, in denen Namen, Pronomen und Rollen nicht nur beschreiben, sondern verleihen und verpflichten³. In dieser Spannung liegt ein Erkenntnismoment, das Sancho und die anderen abwehren, weil es die Bequemlichkeit des Gegebenen infrage stellt.
Die Befreiung der Galeerensträflinge ist ein weiterer Höhepunkt dieser Logik. Don Quijote sieht in den Gefangenen Opfer der Ungerechtigkeit und bricht ihre Ketten. Dank bleibt aus. Die Befreiten schlagen ihn nieder und rauben ihn aus. Man kann das als moralisches Desaster lesen, man kann es aber auch als reinsten Ausdruck von Freiheit als Imperativ verstehen⁴, unabhängig vom Ergebnis. Don Quijote handelt nicht aus Kalkül, sondern aus einem inneren Gebot. Er folgt einer Maxime, Befreie die Unterdrückten, die er für allgemein gültig hält, selbst wenn die Welt sie bestraft. Die Frage, ob es funktioniert, ist hier zweitrangig, entscheidend ist die Wahrheit des Sollens.
Am Ende liegt Don Quijote im Sterben. Er erwacht aus seinem Wahn, nennt die Ritterromane Lügen und kehrt zurück in die Realität als Alonso Quijano. Die Vernunft scheint zu siegen. Wer das Buch gelesen hat, spürt jedoch einen anderen Ton. Dieses Ende bedeutet Verlust⁵. Es stirbt dabei nicht primär der Irrtum, sondern die Fähigkeit, die Welt anders zu sehen. Mit Don Quijote stirbt die Utopie, Europa richtet sich im Realismus ein, in einer Welt, die Ideale als unrealistisch abtut. Sein Tod ist die Ernüchterung einer Kultur, die das Unmögliche nicht mehr denkt.
Cervantes hat kein Buch über einen Verrückten geschrieben, sondern einen Spiegel geschaffen⁶. Zwischen Sancho, dem Zyniker, und Don Quijote, dem Träumer, schwankt der Mensch. Zu viel Nähe zur Erde führt zur Kleinlichkeit. Zu viel Nähe zur Idee führt zur Lächerlichkeit. Erst im Schwanken zwischen beiden Polen entsteht etwas, das man Würde nennen kann. Don Quijote steht nicht als Beweisfigur für Realitätsverweigerung, sondern als Erinnerung daran, dass die Welt aus Fakten besteht und zugleich aus Möglichkeiten.
Die Wirkung dieser Haltung auf moderne philosophische Debatten ist unübersehbar. Don Quijote wirkt wie ein philosophischer Sprengsatz in Auseinandersetzungen zwischen Idealismus und Pragmatismus, und er konfrontiert beide Seiten mit blinden Flecken. Auf der Seite des Idealismus formuliert sein Handeln eine Provokation. Ideen können die Welt formen, selbst wenn sie empirisch scheitern. In kantischer Perspektive trennt die Vernunft zwischen der Ding-an-sich-Welt und der phänomenalen Welt. Don Quijote ignoriert diese Grenze und zwingt die Idee in die Erscheinung. Er scheitert, und doch zeigt dieses Scheitern, dass Wahrnehmung nie ohne Begriffe auskommt, dass Wirklichkeit interpretativ verfasst ist⁸. Der konstruktivistische Gedanke, dass Welten gemacht werden, erhält hier seine dramatische, literarische Szene⁹. Deutscher Idealismus liest den Fall anders und ergänzt ihn. Hegel würde sagen, die Zeit war nicht reif für den Anspruch des Ritters, der Geist noch nicht bei sich; Fichte würde daran erinnern, dass das Ich durch Tathandlung Welt setzt, der Ritter aber an der Gegenhandlung der Welt scheitert¹⁰. Phänomenologisch erinnert uns seine Wahrnehmung daran, dass Sehen stets Deuten ist, dass Objektivität ohne Horizont eine Fiktion bleibt¹¹. Diese Linien gehen in aktuelle Bewegungen über. Wenn #MeToo verborgene Gewalt sichtbar macht oder Klimaproteste das Als-ob der kommenden Generationen ins Heute holen, arbeitet darin dieselbe Grammatik der Idee, die Wirklichkeit herausfordert und neu justiert.
Auf der Seite des Pragmatismus stellt Don Quijote die Nützlichkeit ins Gericht. William James fragt, was sich bewährt, und Don Quijote antwortet, dass Würde nicht durch Bewährung gemessen werden kann¹². Richard Rorty schlägt vor, große Wahrheiten privat zu halten und öffentlich an Nützlichkeit zu orientieren, während Don Quijote seine Idee öffentlich riskiert und damit den Komfort dieser Trennung sprengt¹³. Bruno Latour fordert, die Dinge als Akteure ernst zu nehmen, und Don Quijote zeigt zugleich, dass Dinge Bedeutung tragen, weil Menschen sie mit Sinn beladen¹⁴. Diese Konstellation führt zu einer Synthese, die man pragmatischen Idealismus nennen kann. Der Glaube an absolute Werte verbindet sich mit dem Drang, sie in Handlung zu überführen, auch wenn die Mittel scheitern. Beispiele der Gegenwart folgen dieser Grammatik des Als-ob. Kunst als Handlung bei Joseph Beuys setzt Realität durch Setzung in Bewegung. Aktivismus, von Extinction Rebellion bis zu den Klimaprotesten, stört das Funktionierende, um ein anderes Mögliches sichtbar zu machen. Technische Utopien, von Marsplänen bis Metaverse, verschieben Diskurse, selbst wenn sie an der Welt reiben und an Grenzen prallen¹⁵.
Der Preis bleibt sichtbar. Idealismus riskiert Weltfremdheit, Pragmatismus riskiert Zynismus. Don Quijote zwingt dazu, beides nicht als Endstation zu akzeptieren. Scheitern wird zur Methode, die Frage nach Wahrheit und Würde offenzuhalten. In der KI-Ethik steht Effizienz gegen Gerechtigkeit. In der Klimapolitik steht das Machbare gegen das Notwendige. In der Demokratie steht der schnelle Mehrheitswille gegen Rechte, die Mehrheiten begrenzen sollen. Diese Konfliktlinien berühren nicht nur Institutionen, sondern auch die Frage zugeschriebener Würde in Identitätspolitiken, in denen Personen verlangen, als das anerkannt zu werden, was sie sein sollen, und nicht nur als das, was sie scheinen. Die Figur des Ritters aus der Mancha stört beide Lager und bewahrt der Diskussion ihr Pathos der Möglichkeit. Vielleicht liegt darin die eigentliche Wahrheit des Romans. Die Welt, die nicht ist, kann die einzige sein, die uns rettet⁷. Wir alle leben zwischen Sancho und Don Quijote, zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte. Die entscheidende Frage lautet am Ende nicht, ob Don Quijote verrückt war, sondern ob wir es geworden sind, weil wir aufgehört haben, gegen Windmühlen zu kämpfen.
Hinweis zum Datenschutz (YouTube)
Beim Abspielen eingebetteter YouTube-Videos werden Daten an YouTube/Google übermittelt (z. B. IP-Adresse, Geräte-Infos, ggf. Cookies). Es ist möglich, dass Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden. Es gelten die Datenschutzerklärung von Google und die
Nutzungsbedingungen von YouTube.
Zwischen den klassischen Fassungen gibt es auch moderne Neuinterpretationen. Eine davon erschien 2015/2018 und wurde unter anderem von David Beier und Dave Dorsey inszeniert. Der Trailer, der seit 2018 online kursiert, erzählt Don Quijote als Parabel auf soziale Ungleichheit: ein alter Landbesitzer, der nicht untätig bleiben will, während die Reichen sich bereichern und die Armen darben. In klappriger Rüstung und mit unerschütterlichem Pathos zieht er los, um der „edelste Ritter der Geschichte“ zu werden – auch wenn es ihm an Erfahrung mangelt.
Mit James Franco in einer der Hauptrollen zeigt diese Version, wie aktuell Cervantes’ Romanstoff bleibt: Don Quijote lässt sich jederzeit neu erzählen, sei es als Kritik an Macht und Reichtum, sei es als universale Geschichte vom Scheitern und vom Mut, dennoch weiterzukämpfen.
Das Video von BR-alpha, ausgestrahlt in der Reihe Klassiker der Weltliteratur und moderiert von Tilman Spengler, behandelt ebenfalls den Roman Don Quijote. Spengler stellt Don Quijote und Sancho Panza als literarische Figuren vor, die weit über die Komödie hinausweisen: Sie verkörpern den spanischen Nationalcharakter, spiegeln zugleich Ironie und Selbstkritik und zeigen in ihrer Mischung aus Groteske und Philosophie den ewigen Kampf zwischen Idealismus und Wirklichkeit.
Quellenhinweise & weiterführende Links
- Kant, Kritik der reinen Vernunft – zum Begriff der Erscheinung und Grenze des Erkennens. Stanford Encyclopedia
- Lacan, Das Seminar VII: Die Ethik der Psychoanalyse – Begehren und Identifikation. Übersicht
- Butler, Das Unbehagen der Geschlechter – Performativität und Zuschreibung von Würde. Routledge
- Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten – Handeln aus Pflicht. Stanford Encyclopedia
- Benjamin, Der Erzähler – Roman und Erfahrungsschwund. Übersicht
- Barthes, Der Tod des Autors – Leser als Ort der Sinnstiftung. Übersicht
- Agamben, Die kommende Gemeinschaft – Möglichkeit statt Identität. U Minnesota Press
- Kant, Transzendentaler Idealismus – Phänomen/Noumenon. Stanford Encyclopedia
- Goodman, Weisen der Welterzeugung – konstruktive Welten. Harvard Univ. Press
- Hegel, Phänomenologie des Geistes – Zeitreife der Idee; Fichte, Wissenschaftslehre – Tathandlung des Ich. SEP Hegel · SEP Fichte
- Husserl, Ideen I; Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung – Intentionalität und leibliche Wahrnehmung. SEP Husserl · Routledge
- James, The Will to Believe – Bewährung und Glaube. Project Gutenberg
- Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity – privates/öffentliches Vokabular. Princeton Univ. Press
- Latour, Wir sind nie modern gewesen – Parlament der Dinge. Harvard Univ. Press
- Beuys, Reden/Projekte; Debatten zu zivilem Ungehorsam und Tech-Utopien – exemplarische „Als-ob“-Praxis. Überblick Beuys · Civil Disobedience · Mars-Programm





 © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche © Bildrechte: La Dernière Cartouche
© Bildrechte: La Dernière Cartouche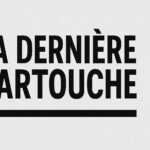 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS






















 © Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS
© Bildrechte: La Dernière Cartouche / LdLS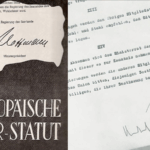 © Bildrechte: La Dernière
© Bildrechte: La Dernière 
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!
Bei La Dernière Cartouche dürfen Sie leidenschaftlich diskutieren – aber bitte mit Stil. Keine Beleidigungen, kein Off-Topic, kein Spam. Persönliche Angriffe gegen Autor:innen führen zum Ausschluss.
🇫🇷 Règles de commentaire :
Sur La Dernière Cartouche, vous pouvez débattre avec passion – mais toujours avec style. Pas d’insultes, pas de hors-sujet, pas de spam. Les attaques personnelles mènent à l’exclusion.